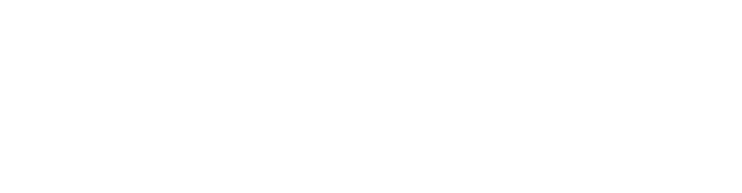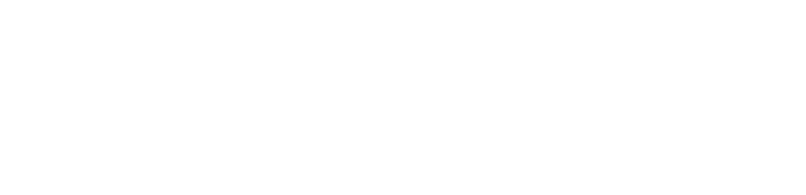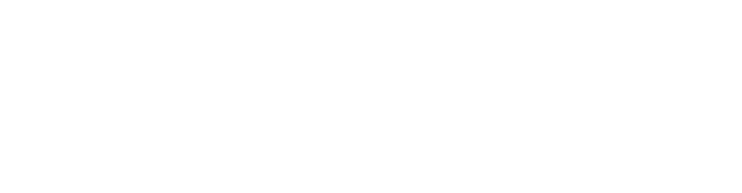Die Rechtsprechung des BVerfG zum Parteienfinanzierungsrecht ist kein Ruhmesblatt. Vom ursprünglich behaupteten verfassungsrechtlichen Verbot einer staatlichen Teilfinanzierung der politischen Parteien hat sich das Gericht zwar schon 1992 verabschiedet, es damals aber noch für erforderlich gehalten, seinen eigenen Meinungswandel zum Inhalt der Verfassung durch die Erfindung einer weiteren verfassungsrechtlichen Vorgabe abzufedern, der sogenannten absoluten Obergrenze. Das jüngste Urteil zur Parteienfinanzierung bot die Gelegenheit, diese Erfindung aufzugeben oder jedenfalls in ihrer Begrenzungswirkung auf ein angemessenes Maß zurückzuführen. Diese Gelegenheit hat der Zweite Senat verpasst. Tragfähige Gründe dafür gibt es nicht, lediglich ein auf die Stellung des Gerichts selbst bezogenes Motiv: Nicht der Gesetzgeber soll über die Höhe der staatlichen Mittel für Parteien entscheiden dürfen, sondern die Mitglieder des Zweiten Senats. Die Entscheidung über den Kontrollmaßstab ist also für die Verfassungsrichter eine Entscheidung in eigener Sache. Kontrolliert wird aber nicht nur das Ergebnis des Gesetzgebers, sondern auch seine Begründung. Und so wurde ein Gesetz für nichtig erklärt, obwohl die darin angeordnete Erhöhung der staatlichen Mittel für die Parteien auch nach den Feststellungen des Zweiten Senats dem Grunde und wahrscheinlich auch dem Umfang nach nicht zu beanstanden war, den Richtern aber die Begründung nicht intensiv genug war. Das verdient neben einer näheren Analyse vor allen Dingen klarer Kritik.