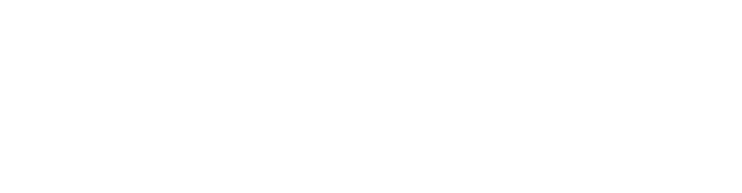
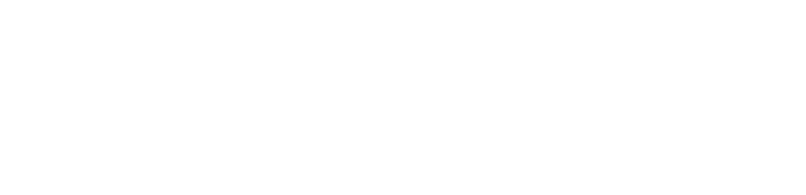
Der Numerus clausus ist nicht nur ein Grundprinzip des deutschen Sachenrechts - auch in Frankreich und England hat er eine erhebliche Bedeutung. Im Bereich der Nutzungsrechte hat sich die Rechtsprechung nun in den letzten Jahren sowohl in Frankreich als auch in England bewusst vom Numerus clausus distanziert. In den Entscheidungen Maison de Poésie (2012, 2016, 2019, 2023) und Aigle Blanc (2018) hat die Cour de cassation mit dem droit réel de jouissance spéciale ein neuartiges dingliches Nutzungsrecht zugelassen. Fast zeitgleich ließ der englische Supreme Court in der Entscheidung Regency Villas v Diamond Resorts (2018) ein neuartiges recreational easement zu. Ist es an der Zeit, auch das deutsche Sachenrecht zu überdenken?
Wenn nachhaltige Entwicklung als zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts auf das bürgerliche Sachenrecht des Jahres 1900 trifft, sind Spannungen vorprogrammiert. Das Eigentum als absolutes Herrschaftsrecht des Einzelnen ist mit gemeinwohlorientierten Nachhaltigkeitserwägungen nicht ohne Weiteres vereinbar. Gleichwohl lassen sich Nachhaltigkeitsaspekte verschiedentlich heranziehen, um hergebrachten sachenrechtlichen Wertungen neue Impulse zu geben. Wird Nachhaltigkeit auf diese Weise doch noch zu einem sachenrechtlichen Grundprinzip?
This article examines whether abuse of rights constitutes a general legal doctrine in Icelandic law, focusing on its application in property law, through doctrinal analysis and a comparative survey of other Nordic legal systems. Property ownership grants individuals broad authority over their assets, but legal systems impose limits to prevent harmful uses. While Icelandic law recognizes the principle of nuisance, which restricts property use that harms or significantly inconveniences others, it remains unclear whether a general prohibition against abuse of rights exists. Unlike other Nordic countries, Iceland lacks recognition of the abuse of rights doctrine, yet related legal principles have been acknowledged. This article concludes that Icelandic law should recognize the abuse of rights doctrine to complement existing legal doctrines. It also suggests that public interest considerations, including environmental and sustainability concerns, could play a role in shaping an Icelandic abuse of rights doctrine.
Tässä artikkelissa keskitytään maakaaren muutoksiin kiinteistöjen vakuuskäytön kannalta. Kiinteistöjen vakuuskäyttöä ajatellen maakaaren merkittävimmät muutokset liittyvät kirjaamismahdollisuuksien parantamiseen. Nyt tehdyillä muutoksilla mahdollistetaan kiinteistöä koskevan panttaamattomuussitoumuksen kirjaaminen sen sivullissitovuuden varmistamiseksi, rahoitusyhtiön sale and lease back (myynti ja takaisinvuokraus) -sopimukseen perustuvan omistusoikeuden kirjaaminen erityisenä oikeutena ja vesialuekiinnitykset. Tässä artikkelissa pureudutaan panttaamattomuussitoumuksen sekä sale and lease back -järjestelyn kirjaamista koskeviin säännösmuutoksiin. Artikkelin tarkoituksena on tutkia, kuinka maakaaren kirjaamista koskevat säännökset ovat muuttuneet silmällä pitäen panttaamattomuussitoumuksia ja sale and lease back -järjestelyjä sekä sitä, miten näitä uusia säännöksiä tulee tulkita.
Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurden ungefähr 2200 Personen von der EU mit sogenannten „smart sanctions“, also personenbezogenen Sanktionen, belegt. Zu den sanktionierten Personen gehören auch systemferne Wirtschaftseliten, die an dem Angriff und Krieg in der Ukraine nicht zurechenbar beteiligt sind; ihr in der Europäischen Union (EU) befindliches Eigentum wurde eingefroren und die Ein- und Durchreise durch EU-Staaten wurde ihnen untersagt. Der Artikel fokussiert sich auf das Einfrieren des in der EU befindlichen Eigentums. Schon die Auslegung von Art. 215 Abs. 2 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) wirft wegen der sehr unklaren Voraussetzungen einer Sanktionierung natürlicher und juristischer Personen Fragen auf. Das gleiche gilt für den konkreten Sanktionsbeschluss des Rats sowie die Rechtsprechung des Gerichts der Europäischen Union (EuG) in den Fällen, in denen die betroffenen Wirtschaftseliten gegen die Sanktionen geklagt hatten. Auf jeden Fall ist nach nunmehr mehr als zwei Jahren Krieg angesichts der Tatsache, dass die Russische Föderation durch die Sanktionen zumal der betroffenen Eliten kaum bzw. überhaupt nicht beeindruckt scheint, klar, dass die Sanktionen zur Erreichung ihres Ziels, nämlich einer Änderung der russischen Politik, nicht geeignet sind und deswegen das Grundrecht des Eigentums der betroffenen systemfernen Wirtschaftseliten rechtswidrig beschränkt ist. Dazu stellt sich die Frage, ob nicht auch ihre Menschenwürde verletzt ist, da ihnen gegenüber mit diesen rein symbolischen Sanktionen ein Exempel statuiert wird.
The right to be heard, a general principle and fundamental right in Union law, requires the administration to hear the persons negatively affected by a decision before taking it. The right must be observed even in the absence of ordinary legislation that provides for hearings in a given administrative procedure. One hitherto unexplored aspect of the right is that its holders are not only individuals, but also Member States, when subject to Union administrative power. This article maps some of the instances where the Court of Justice of the European Union (CJEU) has recognized the right of Member States to be heard. The article further highlights that the ambiguous role of the Member States in European administrative law raises doubts as to when, and to what extent, they should be treated, not as subordinate co-enforcers of Union law under the coordination of the Union administration, but as subjects of the Union administration, with interests of their own that warrant procedural protection before an adverse decision is taken. Ultimately, CJEU case law fails to provide a clear test to establish when the right to be heard of Member States applies. This, the paper argues, risks undermining constitutional requirements of national self-determination, autonomy of Union law, and the balance of power between the Union and the Member States.
Trade and sustainable development (TSD) chapters so far included in EU free trade agreements (FTAs) have been considered to have a mere promotional aim. However, in 2022 the European Commission announced a new approach towards TSD chapters in FTAs. This new attitude raises doubts not only about the breadth of the scope of the common commercial policy (CCP), and so on the need for the new generation of TSD chapters to be grounded on an ad hoc legal basis, but also on the nature of the environmental component of TSD chapters’ provisions. The article concludes that the new approach towards TSD chapters seems to inaugurate an environmental conditionality policy, even if somehow ‘softened’.
Der Beitrag befasst sich mit der Klauselrichtlinie (Richtlinie 93/13/EWG) und der Frage, welche Rechtsfolgen die Verwendung missbräuchlicher Klauseln für den Vertrag insgesamt nach sich zieht. Es wird gezeigt, dass die Rechtsprechung des EuGH auf diesem Gebiet zwei unterschiedlichen – und schwer miteinander vereinbaren – Regelungszielen folgt: der Wiederherstellung eines vertraglichen Gleichgewichts zwischen den Parteien einerseits und der wirksamen Abschreckung von Unternehmern vor der Verwendung missbräuchlicher Klauseln gegenüber Verbrauchern andererseits.
This article analyses the recently adopted Product Liability Directive, exploring the background and reasons for the new instrument and the changes ushered in by the new rules. These modifications impact on key aspects of the liability regime including the expanded concept of a product, the notion of defect, recoverable harm, burden of proof and related evidential matters. It regrets that some other fundamental issues relating to the intended strictness and rationales for strict liability were not addressed.
Union citizens who claim family reunification rights against their home Member State based on the exercise of freedom of movement under Article 21(1) Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) might be suspected of abuse of Union law. The concept of genuine residence, introduced in the Court of Justice of the European Union (CJEU) judgment C-456/12 O. and B. may, together with time, serve to rebut such accusations and affirm the accompanying family member’s right to derive a right of residence from the Union citizen in the latter’s home Member State. The article analyses the CJEU judgments in Case C-456/12 O. and B., Case C-165/16, Lounes, and Case C-230/17, Deha Altiner and Ravn to assess the various ways that temporal factors inform the understanding of what constitutes a created, strengthened or continuous family life, as well as the relevance of the timing in establishing a family relationship. The analysis finds that fixed normative time limits might well serve a function to avert abuse of rights, but risks blurring the reality of family life and the actual need for protection of residence rights of family members to Union citizens in free movement situations.
Das Schengener Abkommen feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag und hat ein Freizügigkeitsregime etabliert, das mit Fug und Recht als Erfahrungsraum der europäischen Integrationsidee bezeichnet werden kann. Durch die Wiedereinführung von nationalen Binnengrenzkontrollen ist Schengen indes in akuter Gefahr. Anstatt eines populistischen Narrativen folgenden flächendeckenden Rückbaus bedarf es problemorientierter, gemeineuropäischer Lösungsansätze.
Die zentrale These des Beitrags lautet, dass die EU über eine supranationale Verfassungssymbolik verfügt. Die EU-Symbole repräsentieren die EU gegenüber Drittstaaten und internationalen Organisationen und wirken innerhalb der EU-Mitgliedstaaten integrierend und identitätsstiftend. Indem sie sowohl außerhalb als auch innerhalb der Hoheitssphäre der EU spezifische rechtliche Funktionen erfüllen, kommen sie Staatssymbolen näher als Symbolen internationaler Organisationen, welche sich auf eine Repräsentationsfunktion nach außen beschränken.
The EU sanctions against Russia and the Russian counter-sanctions have significantly disrupted trade, supply chains and contractual relationships and triggered numerous disputes, which are often settled through arbitration. European legal systems offer several instruments for legally overcoming obstacles to performance caused by sanctions, including force majeure, impossibility, frustration of contract and clausula rebus sic stantibus. Despite dogmatic differences, these largely coincide in their practical solutions. To further increase legal certainty, however, it is advisable for contracting parties to include individually tailored clauses in their contracts.
An Prozessfinanzierungsmodellen scheiden sich die Geister: Während die Anbieter darauf verweisen, in vielen Fällen einen effektiven Rechtsschutz erst zu ermöglichen, erkennen Vertreter aus Politik und Wirtschaft zuvörderst Gefahren für beide Parteien sowie für die Rechtspflege. Die politische Debatte und die jüngere BGH-Rechtsprechung mündeten für die Drittfinanzierung von Verbandsklagen in einen inkohärenten Rechtsrahmen als gegenwärtiges (Zwischen-)Ergebnis. Unterdessen hat das Europäische Parlament eine strenge Regulierung der Finanzierer sowie zwingende Vorgaben für Finanzierungsabreden vorgeschlagen. Der Beitrag systematisiert die regulatorischen Fragestellungen und versucht, Antworten zu geben. Nicht zum Untersuchungsgegenstand gehören finanzierungsneutrale Inkassofragen, etwa ob eine fiduziarische Abtretung bei Überschreitung der Inkassoerlaubnis unwirksam ist.
Public procurement plays a crucial role in driving economic activity and innovation, yet its complexity often creates barriers for stakeholders, particularly small and medium enterprises. This article explores how visual contracting ‒ using diagrams, illustrations, and other graphic tools ‒ could improve clarity and accessibility in public procurement processes. By offering a comparative analysis of systems in Denmark and Australia, the article examines the practical benefits of visual contracting, such as enhanced comprehension, reduced disputes, and improved communication between contracting parties. The discussion includes an evaluation of the legal and practical considerations, including enforceability, costs, and challenges of implementation. With examples and blueprints for applying visual contracting, this research provides a thoughtful exploration of its potential to complement existing procurement practices. The findings aim to inform policymakers, legal practitioners, and procurement officials about the opportunities for simplification and collaboration in public contracting. This article offers an engaging perspective on a novel approach to streamlining procurement processes, grounded in practical insights and comparative analysis.
Current sorting practices in the provision of welfare, used in processes like categorising welfare recipients into cohorts for activation policies, rely on the data inputted into the system. With the introduction of digitalised processes and automated administrative practices, increasingly the creation of this data is undertaken without interaction between the citizen and an agent of the state. Thus, digital forms and processes of information collection and categorisation take on an increased importance, through their role as an interfacing technology that produces the data underpinning automated and digital processes, transforming how citizens experience bureaucracy and administrative processes. This paper explores this ongoing transformation in the emergent digital welfare state, examining how administrative work is changing, and the implications this has for the administrative data that is used to determine who gets access to the welfare state, and how much support they might receive. Using one of the key forms in Australia’s recent changes to a ‘digital first’ welfare model in 2022 as an example, the paper examines the potential impacts on citizens caused by the administrative burdens associated with navigating the online system and correctly providing the relevant information without an agent of the state to assist them.
Akteneinsichtsrechte im behördlichen Verfahren stehen grundsätzlich den Beteiligten des Verwaltungsverfahrens zu. In der Praxis kommt es immer wieder zu Problemen und Rechtsstreitigkeiten, wenn weitere Personen Einsicht in behördliche Akten nehmen wollen und auch ein entsprechendes Recht dazu haben. Zum Teil können diese Personen Akteneinsichtsrechte aufgrund der Informationsfreiheitsgesetze geltend machen, zum Teil gibt es mittlerweile – ähnlich wie im Umwelt- und Naturschutzrecht – in acht Bundesländern Mitwirkungs- und Klagerechte und damit verbundene Akteneinsichtsrechte anerkannter Tierschutzorganisationen. In dem folgenden Beitrag soll das Akteneinsichtsrecht im behördlichen Verfahren – für Beteiligte im engeren Sinne, aber auch für weitere Personen, insbesondere anerkannte Tierschutzorganisationen – beleuchtet und ein aktuelles Problem aus der Praxis dargestellt werden, das sich regelmäßig stellt: Das Recht auf die „Mitnahme“ der Akteninhalte durch Kopieren/Abfotografieren der Akte.
Mit der KI-Verordnung (KI-VO) versucht die Europäische Union, ihre Vorreiterrolle bei einer grundrechtswahrenden Ausgestaltung der digitalen Gesellschaft zu zementieren. In Japan – einem zu Unrecht in Europa eher wenig beachteten Mitbewerber im „Wettbewerb um die Zukunft“ – beobachtet man diese Entwicklung mit großem Interesse. Noch deutlich mehr als in Europa sieht man sich in Japan unter einem immensen Druck, die Digitalisierung des Landes zu einem Erfolg zu führen. Der Beitrag widmet sich der Frage, wie sich Japan hinsichtlich der Regulierung von KI positioniert hat – und welche Gründe für die erfolgte Positionierung maßgeblich sein könnten.
Do firms with higher legality standards contribute to better procurement outcomes? We address this question in the context of Italian public works procurement, by combining contract-level data on procurement and firm-level data on legality scores, using the Legality Rating System managed by the Italian Antitrust Authority. We find that higher legality scores are positively associated with a significant and economically important improvement in procurement efficiency, measured by shorter time delays and lower extra costs.
Verantwortlichkeit der Plattformbetreiber insbesondere im Hinblick auf Kinder- und Jugendschutz sind gegenwärtig Gegenstand gesellschaftlicher Debatten. Den Betreibern von Social Media Plattformen in Australien ist seit November 2024 verboten, Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren die Nutzung über einen eigenen Account zu ermöglichen. Der Beitrag untersucht, ob ein solches gesetzliches Verbot auch in Deutschland eingeführt werden sollte.
Die europäische Plattformregulierung hält Vorkehrungen zur Sicherung des demokratischen Diskurses bereit. Dem nationalen Gesetzgeber bleibt die Pflicht der Vielfaltssicherung. Die Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu einem ‚Public Open Space‘ birgt die große Chance, eine gemeinwohlorientierte und kooperative Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen.
Sukzessive entfalten einzelne Bestimmungen der unionalen KI-Verordnung Wirkung. Die Verwaltung kann als Anbieter und/oder Betreiber von KI-Systemen den allgemeinen, aber auch besonderen Pflichten unterliegen. Ergänzend werden die Überwachungs- und Aufsichtskompetenzen für den direkten und indirekten Vollzug der Verordnung beleuchtet, die – je nach nationaler Umsetzung im föderalen Staat und im Zusammenspiel mit den Behörden anderer Mitgliedstaaten – zu einem verstärkten Durcheinander von Zuständigkeiten führen und damit die Überwachung und Durchsetzung erschweren können. Kritisch ist zudem die umfangreiche Befugnis der EU-Kommission, substanzielle inhaltliche Änderungen an der KI-Verordnung vornehmen zu können.
The principle of equality is a foundational element in public procurement systems across diverse legal jurisdictions. Acknowledging the conceptual complexity and multifaceted nature of equality, this article argues that a structured sub-categorisation of the principle reveals its depth and operational significance within public procurement law. It identifies and explores seven distinct notions of equality: relevant equality, equality in competition, reliance and equality, transparency as equality, equality through consistency, equality by rules, and equality of allocation. Ultimately, this analysis aims to clarify the varied manifestations of equality in public procurement, offering a framework for understanding its normative force and its interaction with other public procurement principles.
Der Beitrag befasst sich mit der Relevanz der neuen KI-VO der EU für das mitgliedstaatliche Schulrecht. Im Mittelpunkt steht eine Analyse des rechtlichen Verhältnisses der KI-VO zu den Schulgesetzen der Länder. Dabei werden insbesondere die Regelungsspielräume des Schulgesetzgebers ausgelotet. Exemplarisch werden einzelne Anwendungsfälle für den Einsatz von KI in Schulen und Unterricht am Maßstab der KI-VO geprüft.
Der Beitrag möchte das Beispiel der Schule aufgreifen, um anhand dessen eine detaillierte Analyse der verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen von „Gender-Debatten“ vorzunehmen. Dies geschieht in der Hoffnung, durch eine genaue Überprüfung der verfassungsrechtlichen Salienz verbreiteter Argumente etwas Klarheit in die Debatte zu bringen. Zudem möchte ich die Perspektive der Grundrechte von Schülerinnen genauer beleuchten. Im Folgenden werde ich zunächst die historische Entwicklung des sogenannten Amtlichen Regelwerks zur deutschen Rechtschreibung umreißen, die einen immer noch wichtigen Hintergrund der aktuellen Debatten bildet, und kurz die bisherigen Regelungen in den verschiedenen Bundesländern darstellen(II.). Anschließend unterscheide ich zur verfassungsrechtlichen Bewertung der „Genderdebatte“ drei Problemkomplexe: Zunächst widme ich mich der Frage, ob staatliche Schulen geschlechtssensiblere Sprache verwenden dürfen (III.) und wann sie es sogar müssen (IV.), sodann, ob und wie Freiheitsrechte von Schülerinnen von entsprechenden Verboten berührt werden (V.). Zuletzt ordne ich die bisherigen Regelungsversuche in den größeren Kontext der politischen Debatte ein und zeige auf, wo der aktuelle rechtswissenschaftliche Diskurs zu dem Thema zu verengen droht (VI.).
Polizeivollzugsbeamte vertreten das staatliche Gewaltmonopol, nötigenfalls mit Waffengewalt. Anders als nichtstaatliche Waffeninhaber trifft sie keine bundesweit einheitliche Prüfung ihrer Verfassungstreue. Der folgende Beitrag nimmt dieses rechtliche Gefälle auf und beleuchtet die Notwendigkeit einer flächendeckenden Einführung von Regelanfragen für angehende Polizeivollzugsbeamte.
Ab dem 12.9.2025 sind die wesentlichen Vorschriften des Data Act anwendbar. Dieser letzte und wichtigste Baustein der „europäischen Datenstrategie“ verändert die Spielregeln der Datenwirtschaft tiefgreifend. Trotzdem haben sich nicht alle betroffenen Unternehmen ausreichend vorbereitet. Der Beitrag erläutert im Schwerpunkt, wie der Zugang zu Daten von vernetzten Produkten in Zukunft ausgestaltet ist und welche Stellung die Inhaber von Daten, die Nutzer von vernetzten Produkten und etwaige Dritte dabei haben.
Virtually all relevant legal frameworks mandate the exclusion of entities involved in fraudulent, corrupt, collusive, coercive, obstructive or otherwise dishonest practices from participating in procurement procedures. Many jurisdictions and international organisations reinforce this exclusion through exclusion or debarment lists, i.e. registers containing information on excluded entities. However, within the European Union (EU), the prevalence and rationale behind the use of such registers have not been extensively examined. This article intends to fill this gap by providing a comprehensive overview of the use of exclusion lists by EU institutions and EU Member States, with a particular focus on the EU’s early-detection and exclusion system ( EDES) database. It also explores the benefits and drawbacks of using exclusion lists. The article concludes by advocating for the creation of an EU-wide exclusion list to address some of the identified challenges. It would apply to contracting authorities in Member States as well as the EU institutions, building upon the exclusion grounds and procedural rules currently contained in the EU’s Financial Regulation and the Procurement Directive. Such list could further ensure a level playing field within the EU, enhancing fairness, transparency, and trust in public procurement.
Annex ‒ exclusion lists in EU Member States (gives an overview about the use of exclusion lists in all EU Member States).
Interoperabilität ist, so scheint es, das Gebot der Stunde. Am 5. Dezember 2024 traf sich in Brüssel erstmals der Beirat für ein interoperables Europa. Dieser Kreis dient der operativen Umsetzung des Interoperable Europe Acts und setzt sich aus Vertretern der EU-Mitgliedstaaten, der Kommission, des Ausschusses der Regionen und des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zusammen. Ziel ist es, die grenzüber-
schreitende Interoperabilität und Zusammenarbeit im öffentlichen Sektor in der EU zu stärken und den digitalen Wandel zu beschleunigen. Zunehmend greift die Erkenntnis um sich, dass es nicht mehr genügt, Verwaltungsportale zusammenzuschließen (oder gar nur eine Pflicht hierzu vorzusehen), sondern dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Angebote auch tatsächlich miteinander kommunizieren können. [---]
Framing non-consensual, medically unnecessary interventions as human rights violations has become a priority for global intersex movements in recent years. However, establishing binding legal norms in this area remains challenging. Few countries have prohibited such interventions and scholarly discussions on these bans are still in their early stages. This article offers a contextual case study of Iceland’s 2020 ban, as one of the few countries to outlaw non-consensual, non-therapeutic interventions on children with variations in sex characteristics. Drawing parallels with similar bans in other European countries, the article argues that framing the issue in terms of rights has been effective in mobilising action, building consensus and driving legislation. Yet, the broad and ambiguous framework underlying these laws appears to result in ineffective implementation, making such legislative bans at risk of becoming symbolic achievements for states, offering limited protection and few remedies for intersex people.
The impact of arts 10 and 11 of sch.1 to the Human Rights Act 1998 on criminal prosecutions brought against defendants engaging in public protest activities has received substantial analysis by the higher courts in recent years. Much of this litigation has concerned the offences of obstruction of the public highway and aggravated trespass on privately owned land. Its doctrinal significance has lain in the ‒ short-lived ‒raising of the possibility by the Supreme Court in DPP v Ziegler ([2021] UKSC 23; [2022] A.C. 408) that conviction in such cases would invariably require the prosecution to persuade the trial court ‒ independently of and in addition to proving the various element of the offence simpliciter ‒ that a guilty verdict would be compatible with art.10 and/or art.11 of the Human Rights Act . That presumption now seems to have been misconceived, the Supreme Court having more recently confirmed in In re Abortion Services (Safe Access Zones) (Northen Ireland) Bill ([2022] UKSC 32; [2023] A.C. 505) the conclusions reached by lower courts that convictions for certain criminal offences, even if committed in the context of public protest over political issues, are intrinsically consistent with arts 10 and 11 to the effect that no freestanding proportionality analysis is required. The Abortion Services judgment has described this as a "nuanced" question. This paper traces the ebbs and flows of this argument through the recent case law, and then explores the complexities and difficulties that the evident inconsistencies in this line of authority has created by focusing in detail on its application to the "pure speech" crime created by s.4A of the Public Order Act 1986 in R. (on the application of DPP v Manchester City Magistrates Court and (1) Ruth Wood (2) Radical Haslam ([2023] EWHC 2938 (Admin)) . The argument made is that although a headline reading of the judgment ("Divisional Court approves the acquittal of protesters who called Conservative MP "Tory Scum"") might suggest that the court has approved an expansive approach to the Convention Right protection of public protest speech, a closer analysis indicates that people who wish to couch their political protests in insulting or abusive or threatening terms should tread very carefully before they take the step of expressing their ideas.
Examines ECtHR jurisprudence on the human rights implications of state responses to COVID-19, particularly whether these struck an appropriate balance between public restrictions for protecting life and individuals' rights. Explains the importance of a wide margin of appreciation.
Article 1 of the First Protocol to the European Convention on Human Rights (FP ECHR) ensures the right to the peaceful enjoyment of possessions, which has been the focus of considerable litigation. This paper intends to address the deficiency in a detailed analysis of Article 1 FP ECHR cases by employing data science methods, specifically topic modelling and network analysis. The objective is to identify significant themes within the corpus of judgments and decisions of the European Court of Human Rights (ECtHR) about property rights. By adopting a non-doctrinal approach and introducing a distinctive manually annotated dataset, this paper aims to illustrate the efficacy of integrating topic modelling with network analysis to uncover meaningful subsets of case law and landmark decisions in the areas of property, housing, and eviction.
In AG Spalding & Bros v AW Gamage Ltd (1915) , Lord Parker famously rejected the idea that passing off protects property in unregistered trading signs per se, in favour of a theory that identifies goodwill as the property right underlying the cause of action. This decision is now widely regarded as the moment at which passing off was definitively placed on its modern theoretical foundations. In this article, based on a detailed reading of the case-law and literature on passing off between 1915 and 2025, it is argued that this narrative of the tort’s development conceals a significant, but largely unacknowledged, change that has taken place since Spalding v Gamage . At the time of Lord Parker’s speech, goodwill was envisaged as a relatively undifferentiated right in a claimant’s business. By contrast, the right protected by the law of passing off today is treated as though it subsists directly in individual trading signs. Ironically, it is therefore difficult to distinguish from the property in unregistered marks rejected as a foundation for the tort by Lord Parker. The article begins by explaining the origin and continuing significance of the theoretical framework deriving from Spalding and goes on to demonstrate the different understanding of the protected property (the ‘goodwill in the sign’ model) which prevails today. Having drawn this distinction, it explores the way in which ambivalence about the nature of goodwill in passing off is reflected in the metaphors employed to describe the protected property. It concludes by drawing attention to some of the potential consequences of the major historical shift demonstrated here.
Muotioikeudella tarkoitetaan yleisesti muoti- ja designalaan liittyvien juridisten kysymysten ongelmalähtöistä tarkastelua. Monet muotioikeudellisista kysymyksistä ovat paikannettavissa ainakin osaksi immateriaalioikeuden alueelle, mutta tyypillisesti ne ovat myös limittäisiä tai päällekkäisiä vakiintuneempien oikeudenalojen, kuten ympäristöoikeuden, työoikeuden tai kilpailuoikeuden, kanssa. Artikkelissa tehdään katsaus muotioikeuden kehittymiseen ja historiaan ja tutkitaan sen syntyä yritysoikeudellisen käytännön pohjalta.
The development of the right of communication to the public under art.3 of the Information Society Directive has been one of the most hotly contested EU copyright issues of the last decade. Recently, there have been three significant developments that challenge the original understanding of the concept of "communication to the public". YouTube, the legislative development in art.17 of the Digital Copyright Market Directive and the Digital Services Act raise questions about the future interpretation and application of the concept of "communication to the public". Taken together, these three developments comprise the new frontier for the right of communication to the public. This article will address some of the key challenges likely to be faced in the new frontier, and will additionally propose that a mandatory licensing mechanism is required for the new frontier of the right of communication to the public to be effective in achieving its goals.
Notes the debate over whether the Copyright, Designs and Patents Act 1988 s.9(3), concerning copyright protection of computer-generated works, should be repealed. Reviews the background to, and drafting history of, the regime, and suggests, using hypothetical scenarios, why s.9(3) could be repealed.
Nach der geltenden Rechtslage erlischt das allgemeine Persönlichkeitsrecht mit dem Tod. Der sodann unmittelbar aus Art. 1 I GG abgeleitete „postmortale Achtungsanspruch“ schützt den Verstorbenen dann nur noch vor besonders schweren Eingriffen, etwa durch eine „Lebensbildverzerrung“. Auch das Recht am eigenen Bild ist lediglich zehn Jahre ab dem Tod geschützt, da § 22 S. 3 KUG bestimmt, dass die Verbreitung des Bildnisses des Verstorbenen nur bis zum Ablauf von zehn Jahren der Einwilligung der Angehörigen bedarf. Künstliche Intelligenz (KI) und insbesondere sogenannte Deepfakes machen es inzwischen allerdings möglich, Verstorbene „wieder zum Leben zu erwecken“, und zwar ohne dass man die Fiktion der Darstellung erkennt. Die KI lässt die Toten als „digitale Avatare“ auferstehen. Da hierdurch Missbrauch und Manipulation Tor und Tür geöffnet sind, bedarf es de lege ferenda der Schaffung eines postmortalen Persönlichkeitsrechts.
Der Beitrag beleuchtet eine Eigentümlichkeit des strafrechtlichen Kennzeichenverbots. Dieses sanktioniert Meinungsäußerungen nicht wegen ihres konkreten Aussagegehalts, sondern weil sie abstrakt auf eine verbotene Organisation verweisen. Auf diese Weise drohen verfassungsrechtliche Anforderungen der Meinungs- und Vereinigungsfreiheit ausgehebelt zu werden. Das wird anhand von zwei Beispielen verdeutlicht: der Diskussion um die Strafbarkeit des Slogans „From the River to the Sea“ und der vor allem mit Blick auf die Kennzeichen von Rockergruppen verabschiedeten Änderung des § 9 Abs. 3 VereinsG.
Der Schutz gesellschaftlich marginalisierter Gruppen vor Diskriminierung beschäftigt zunehmend auch den Strafgesetzgeber. In den letzten Jahren wurde das Strafgesetzbuch in dieser Hinsicht mehrfach geändert. Die Reformen nahmen dabei vor allem geschlechtsspezifische, aber auch rassistische und antisemitische Straftaten in den Blick. Vor diesem Hintergrund geht der Beitrag der Frage nach, inwiefern das Strafrecht als ein Baustein eines weitgefassten Antidiskriminierungsrechts begriffen werden kann. So werden erste Überlegungen hinsichtlich der Funktionen, der Leistungsfähigkeit und der Grenzen des Strafrechts im Bereich des Diskriminierungsschutzes angestellt. Zudem werden zentrale Fragen hinsichtlich der konzeptionellen Ausgestaltung eines möglichen »Antidiskriminierungsstrafrechts« aufgeworfen.
Aktuell ist im Strafgesetzbuch keine allgemeine Rückfallvorschrift mehr vorhanden. Im Unterschied dazu sind Rückfallvorschriften in ausländischen Rechtsordnungen keine Seltenheit. Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, ob die Wiedereinführung einer allgemeinen Regelung zum Rückfall auch für Deutschland zu erwägen ist.
Die Natur ist dynamisch, das Naturschutzrecht ist es auch. Es verwundert daher nicht, dass auch in den Jahren 2024 und 2025 nicht nur auf der Ebene der Gesetzgebung, sondern vor allem auch in der Rechtsprechung Bedeutsames geschehen ist. Der vorliegende Beitrag beleuchtet den für die Verwaltungspraxis voraussichtlich wichtigsten Teil dieser jüngeren und jüngsten Entwicklungen.
Artikkelissa selvitetään Suomen argumentteja kahden EU-ympäristösäädöksen neuvotteluissa, joita molempia vastaan Suomi äänesti. Artikkelin keskeisenä tutkimuskysymyksenä on kuvata sosiaalisen ilmastorahaston ja ennallistamisasetuksen valmistelun reaalipoliittista sisältöä EU:n ja Suomen näkökulmasta. Mitä oikeudellisia argumentteja Suomi käytti neuvotteluissa? Ovatko Suomen käyttämät argumentit ”uskottavia” EU-oikeuden näkökulmasta sekä missä määrin Suomen esittämät argumentit onnistuivat vaikuttamaan säädösten valmisteluun?
Dieser Beitrag analysiert, welche Vorgaben das völkerrechtliche Klimaschutzsystem des Pariser Abkommens (PA) für Klimaschutzmaßnahmen in der Tierhaltung macht. Entsprechend seines Charakters als Rahmenordnung enthält das Pariser Abkommen diesbezüglich verschiedene implizite und sehr allgemeine Pflichten. Etwa impliziert die Verpflichtung zu ehrgeizigen Maßnahmen zugunsten des Temperaturziels des Pariser Abkommens gem. Art. 2 Abs. 1 lit. a; Art. 3 S. 1; Art. 4 Abs. 2 PA auch eine Pflicht zu Klimaschutzmaßnahmen in der Tierhaltung. Der durch das Abkommen geschaffene Rahmen wurde durch die Nationally Determined Contributions und Übereinkommen auf weiteren Vertragsstaatenkonferenzen jedoch unzureichend ausgefüllt. Der Umfang, in dem die Vertragsstaaten die Tierhaltung in ihren Nationally Determined Contributions adressieren, ist sowohl quantitativ als auch qualitativ für eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 2°C unzureichend. In den auf Vertragsstaatenkonferenzen des Pariser Abkommens verabschiedeten Übereinkünften findet sich die auch auf nationaler Ebene auftauchende Tendenz wieder, die Tierhaltung aus Klimaschutzbemühungen von vorneherein auszunehmen oder bei tierhaltungsbezogenen Klimaschutzmaßnahmen nur auf Innovationen und Anreize zu setzen. Der Beitrag wirbt für ein globales Tierschutzrecht als Mittel tierhaltungsbezogenen Klimaschutzes und als Gegengewicht zu lauter werdenden Rufen nach Effizienzsteigerungen in der Tierhaltung.
It has been suggested that the growing emphasis on nature restoration reflects a paradigm shift in environmental law and governance. Through a socio-legal analysis of the emerging concept of restoration in law and policy frameworks and in practice in the North Sea, this article reveals that no such shift is currently discernable. It shows that the underpinning conception of ‘nature’ has not changed in the law and governance of restoration, and that restoration thus runs into the same limitations as conventional approaches to conservation rooted in a hegemonic non-relational paradigm. This poses practical challenges for actors currently engaged in restoration initiatives and pre-empts alternative approaches, limiting the transformative potential of the restoration agenda. To overcome this, we propose that centring a relational approach opens up alternative ways of conceptualising and governing nature that are better aligned with the situated experiences, plural values and knowledges of people engaged in restoration practice.
This overview covers a selection of case law relevant to EU environmental law from a pool of more than 60 judgments delivered in 2024 by the Court of Justice of the European Union (CJEU) in the environment and energy area. As in my previous case law overviews for the Journal of Environmental Law, these are presented in two categories: ‘vertical issues’ (here focusing on access to justice and constitutional law and internal market regulation with environmental law ‘spillover’) and ‘sectoral judgments’ (here discussing air quality; nature conservation; waste and water). In each category, entries are listed alphabetically according to theme (for the former) and sector (for the latter). Ultimately, 2024 has been a year where the interpretation of the finer details of many EU environmental laws has continued apace without major principles being either determined or upset. This is despite the intense legislative endeavours under the ‘European Green Deal’, many results of which have not yet reached their implementation date. Consequently, any discussions on the application of these new laws will not reach the CJEU for a while.
Significant amendments to the Belgian Act on Euthanasia were passed in March 2024. The amendments altered the registration form which physicians submit for oversight after the patient has died, the penalties for non-compliance with the law, and the potential liability of practitioners who provide an independent advice in a euthanasia assessment. Two of these amendments addressed judgements delivered by the Belgian Constitutional Court and the European Court of Human Rights. These amendments may have several positive impacts on euthanasia practice, including enhancing practitioners’ compliance with the legal requirements and improving legal certainty. But they may also have negative impacts on practice, including by decreasing practitioners’ willingness to provide euthanasia. Both the intended and possible unintended effects of reforms to Belgium’s euthanasia law should be considered before and after their enactment. This is particularly important when these reforms change provisions which were seen as important when the original law was passed.
The rapid development of information technology has made the sharing and utilization of medical and health data a key factor in promoting medical innovation and improving public health levels. However, China still faces many challenges in the field of medical and health data sharing, including an imperfect legislative system, unclear data ownership, lack of incentive mechanisms, and lagging construction of data sharing platforms. This paper analyzes the current status of medical and health data sharing in China and the existing problems, pointing out that the decentralization and low level of legislation restrict the rational flow and effective utilization of health data. Through comparative analysis with the European Health Data Space, the deficiencies in China’s data sharing are revealed, and drawing on the experience of the EU, corresponding improvement paths are proposed. This paper suggests that measures such as establishing a medical data ownership and authorization mechanism, constructing a diversified benefit distribution mechanism, and building a secure and trustworthy dual-track sharing platform should be taken to promote the efficient utilization and circulation of medical and health data in China. These measures will facilitate the implementation of medical informatization and the medical data sharing strategy.
The present paper explores legal issues concerning connected objects used for health or health-related purposes and their corresponding usage of health and health-related data. It focuses on a patient/healthcare-user-centred perspective and researches the EU legal framework for health data and health-related data. Arguing that the legal framework, as recently complemented with the European Health Data Space (EHDS) Act, is plagued by complex intersections, between this recently enacted legislation and various other legal instruments, e.g. Medical Device Regulation (MDR), General Data Protection Regulation (GDPR), Data Act, Data Governance Act, Artificial Intelligence Act, etc. Furthermore, the legal framework applicable to health and health-related connected objects also contains several grey zones (i.e. areas of legal uncertainty concerning interpretation and applicability of existing norms), and unintended blind spots (i.e. areas potentially left untouched by the existing frameworks). The paper focuses on data quality, acceptability of connected objects, availability and accessibility of data, as well as the overarching topic of privacy and data protection. Concluding that, examined in conjunction, existing regulatory safeguards and certification mechanisms do not offer sufficient protection and simultaneously result in an excessively complex, cumbersome and opaque regulatory framework that has underestimated the specific needs of users in the health and health-related sectors.
The paper analyses and compares the available legal frameworks that protect the autonomy and ensure decision-making rights in physical and mental healthcare for persons with mental disabilities in three Baltic countries — Estonia, Latvia and Lithuania. The decision-making rights of persons with mental and psychosocial disabilities are examined in depth, with respect to the principles outlined in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). The research shows that none of the three Baltic States provide an adequate framework to enable every person with mental health difficulties the ability to exercise autonomous decision-making in healthcare and receive support when needed. There is an urgent need to reform healthcare legislation in all Baltic countries to ensure a paradigm shift towards a human rights-based approach that limits substituted decision-making and enables supported decision-making in healthcare.
Across European legal systems, there is a consensus on the importance of consent in medical ethics as recently emphasised by the European Court of Human Rights in Pindo Mulla v Spain. Yet, consent in medical law poses several challenges in practice which includes the need to reduce mistakes in the consent process. We argue that consent is scalar and includes ‘strong’ consent (where a patient has maximum capacity to express a fully informed, voluntary decision) to weak consent (where a patient has said ‘yes’ but with limited understanding or liberty. We propose a ‘model of disaggregating consent’ which highlights the range of values that consent protects albeit to varying degrees in different cases. We apply our model to the example of organ donation and organ transplantation to illuminate how our model paves the way for improving decision-making in the consent process by factoring in the pluralistic values at play.
Innovative pharmacotherapies such as stem cell-based gene therapy for children experience difficulty receiving financial coverage due to their high costs, barring access for children dependent upon these therapies. This raises the question to which extent states should guarantee financial accessibility of health care for children. Therefore, general principles are deduced using a holistic human rights-based approach with Article 24 CRC as basis. This is the primordial codification for children’s human right to health, delineating, e.g. in European context, Article 8 ECHR. It is concluded that health care which is life-saving, improves development, promotes dignity, or results in inhuman treatment if denied, needs to be made financially accessible by the state; except if the implementation is beyond the maximum extent of available resources. These criteria are useful in the interpretation of the right to health and can answer which innovative health care technologies for children ought to be made financially accessible.
The digitalization of criminal trials in Europe represents a transformative shift from traditional, physical courtroom settings to virtual participation. This transition, though driven by efficiency purposes, cost reduction, and enhanced access to justice, presents great challenges to the right to effective participation at trial as enshrined in Article 6 echr and EU law. By analyzing ECtHR jurisprudence and EU legal instruments, this paper critiques the inadequacy of current approaches adopted by both frameworks, including the ‘normative equivalence’ and ‘tolerable differences’ models, which assumes that physical and digital participation, respectively, to be equivalent or at least, comparable. This article calls for abandoning outdated paradigms, advocating for a new framework rooted in digital rights tailored for a brand-new digital justice, in the light of the 2023 European Declaration on Digital Rights.
Using two of the countries of the DigiRights Project as jurisdictional studies – namely, Belgium and Germany – this article will assess the audiovisual interrogation of (particularly, vulnerable) witnesses as a case study for digitalised criminal proceedings, and so the ideas of virtual and remote criminal justice. The article begins with an assessment of the relevant provisions of Belgian and German criminal procedure law, which are compared in order to determine how the interests of vulnerable witnesses (or witnesses prevented from appearing), and the procedural or fundamental rights of the accused and their defence can be balanced in both jurisdictions in the area of audiovisual questioning of witnesses. Based on a European and transversal analysis, this contribution aims to draw general supranational conclusions regarding the digitalization of criminal proceedings, with an eye to thereafter proffering recommendations for how such digitalisation (and so, therein, remoteness) can be deemed acceptable in the context under discussion.
Aufgrund der Kursschwankungen von Kryptowerten kann bei einer strafprozessualen Beschlagnahme oder Pfändung solcher Vermögenswerte zur Sicherung der gerichtlichen Einziehung von Taterträgen innerhalb kürzester Zeit ein erheblicher Wertverlust drohen. Folglich müssen die Staatsanwaltschaften in diesen Fällen kontinuierlich eine Notveräußerung derartiger Vermögenswerte prüfen. Dabei wird der Staatsanwaltschaft ein gesetzliches Ermessen eingeräumt. Der Beitrag geht der Frage auf den Grund, ob und unter welchen Umständen dieses Ermessen auf Null reduziert sein könnte, so dass die Staatsanwaltschaft zur Notveräußerung verpflichtet wäre.
Im strafprozessualen Schrifttum findet sich die These, dass der Nemo-tenetur-Grundsatz, dh die Freiheit, sich nicht selbst belasten zu müssen, auch auf juristische Personen des öffentlichen Rechts anwendbar sei. So allgemein formuliert, ist diese These im Lichte des Staats- und Verwaltungsrechts nicht haltbar. Sie konfligiert mit dem rechtsstaatlichen Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Nähere Betrachtung zeigt, dass es der Differenzierung im Hinblick auf die unterschiedlichen Agenden und Rechtsformen der öffentlichen Verwaltung bedarf. Die rechtsstaatlichen Besonderheiten hoheitlicher Verwaltungstätigkeiten verbieten, dass der Staat oder ein anderer Verwaltungsträger die in Ausübung eines öffentlichen Amtes begangenen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten unter Berufung auf den Nemo-tenetur-Grundsatz schweigend im Verborgenen hält, statt gesetzwidrige Vorgänge aufzuklären und gesetzmäßige Zustände wiederherzustellen. Die rechtsstaatliche Gesetzmäßigkeit der Verwaltung fordert deshalb Durchbrechungen des strafprozessualen Nemo-tenetur-Grundsatzes.
This paper explores how information technology (IT) contributes to judicial efficiency, that is, to what extent investment in IT helps shorten court delays. It uses information collected by the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), a body of the Council of Europe, from the ministries of justice of 16 of its member countries. A part of this survey, conducted every two years by the CEPEJ, focuses on the judicial services information system, which every country describes by filling up checkboxes. The research augments CEPEJ data by building a maturity index from that material. That index, designed as a proxy to IT asset, is then used as an input to a data envelopment analysis (DEA), alongside two types of human assets : judges and other staff. The average court delays, in criminal and civil matters, are used as outputs to the DEA. One first stage of the analysis applies the directional distance function (DDF), a second one applies the Shapley value, so as to weigh each input’s contribution to the distance from the efficient frontier. Results suggest IT does indeed contribute to shorter court delays, but also that other factors are at play.
Seit jeher bietet der Streit um die Behandlung unverschuldeter Informationsdefizite der darlegungs- und beweisbelasteten Partei zuverlässig Diskussionspotential für die Ausgestaltung der prozessualen Befugnisse der Parteien und des Gerichts. Die jüngste Intervention des europäischen Gesetzgebers im Bereich des Produkthaftungsrechts fällt durch progressive Vorgaben auf und birgt eine Chance zur umfassenden Lösung der Problematik.
Der Zivilprozess soll schneller, effizienter und vor allem unternehmensfreundlicher werden – dies ist jedenfalls das erklärte Ziel des deutschen Gesetzgebers. Zu diesem Zweck hat er das Justizstandort-Stärkungsgesetz erdacht, welches am 01.04.2025 in Kraft getreten ist. Bereits der Titel des Gesetzes wirft zwei Fragen auf: Gegenüber welchen Akteuren soll die intendierte Stärkung erfolgen und wie soll sie erreicht werden?
Am 31.01.2025 hat die Reformkommission »Zivilprozess der Zukunft« im Auftrag des dritten Digitalgipfels der Justizministerinnen und Justizminister des Bundes und der Länder einen insgesamt 240 Seiten starken Abschlussbericht mit ihren Vorstellungen vom künftigen Zivilprozess vorgelegt. Der Schwerpunkt der Vorschläge liegt auf der digitalen Transformation der Ziviljustiz, der Effizienz des zivilprozessualen Verfahrens und der Zugänglichkeit der Zivilgerichte. Insgesamt sollen die Angebote der Ziviljustiz dadurch »passgenauer« zugeschnitten werden. Die Empfehlungen sind konsequent an den Prozessmaximen ausgerichtet, die der Weiterentwicklung des Zivilprozessrechts im Zuge der Digitalisierung konkrete Leitlinien vorgeben.
Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung steht die Verwaltungsgerichtsbarkeit vor besonderen Herausforderungen. Die Verwaltungsgerichte müssen mit einer Vielzahl elektronischer Behördenakten von verschiedenen Herstellern mit differierenden Entwicklungsständen umgehen. Nicht selten setzt die Ausgangsbehörde ein anderes elektronisches Behördenaktensystem ein als die nachfolgende Widerspruchbehörde. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit aktuellen rechtlichen und praktischen Fragen der elektronischen Behördenaktenführung sowie deren Übermittlung an die Verwaltungsgerichte und nimmt insbesondere die neue Behördenaktenübermittlungsverordnung in den Blick, die am 6.5.2025 in Kraft getreten ist.
Das Gesetz zur Stärkung des Justizstandortes Deutschland durch Einführung von Commercial Courts und der Gerichtssprache Englisch in der Zivilgerichtsbarkeit (Justizstandort-Stärkungsgesetz) vom 24.10.2024 ist ein in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerter Rechtsakt. Sein Titel variiert Begriffe, die sonst aus dem Kapitalmarktrecht geläufig sind, wo es häufig darum geht, den „Finanzplatz Deutschland“ zu stärken.
This is the latest in a series of annual surveys in this Journal reviewing dispute settlement in the law of the sea, both under Part XV of the UN Convention on the Law of the Sea (LOSC) and outside the framework of the Convention. The most significant development during 2024 was the delivery of an advisory opinion by the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) in which it spelt out States’ obligations under the LOSC relating to climate change. Other developments included the initiation of proceedings in two new cases, one before the ITLOS between Luxembourg and Mexico regarding the detention of a vessel of the former by the latter, the other an arbitration outside the framework of the LOSC between the European Union and the United Kingdom concerning the conservation and management of sandeels. In the former case, the ITLOS made an order or provisional measures during the year.
Recent main global scientific assessments underscore the alarming deteriorating state of the marine environment. Following an overview of pressures and threats, which are widespread and severe or serious, and relevant policy outcomes, this article evaluates the effectiveness of the international legal regime in addressing these pressures and threats, highlighting implementation, compliance, and enforcement challenges. Some recent developments to address crimes against the environment will be highlighted, in particular initiatives to develop and define a crime of ecocide at international and national levels. Based on the existing definitions of ecocide, the article analyses whether ecocide could be applied in a marine context, with particular attention given to thresholds and the nature of the act. It then considers the potential application in a marine context of some of the components of the definitions of ecocide, with bottom trawling selected for a deeper analysis.
In light of the increased vessel traffic in the marine Arctic, prevention of vessel-source marine plastic pollution is becoming a matter of serious concern. Thus this article examines rules and obligations concerning the prevention of vessel-source marine plastic pollution from Arctic shipping in international law. In broad terms, international law of Arctic shipping consists of three-tier structure: (1) the United Nations Convention on the Law of the Sea (LOSC), (2) special treaties and instruments concerning vessel-source marine pollution and the safety of navigation, and (3) municipal law. A relevant question that arises is how one can prevent normative conflicts between treaties and secure normative coherence. To address this question, first this article reviews the relevant provisions of the LOSC and particular treaties and instruments concerning the prevention of vessel-source plastics pollution from Arctic shipping. Next, the article examines two dimensions of normative interactions between treaties: normative conflicts and normative integration.
Das Posten von Kinderfotos in den sozialen Netzwerken gehört für viele Eltern zum Alltag. Doch wie ist diese Praxis rechtlich zu bewerten? Der Beitrag analysiert den Rechtsrahmen des sogenannten Sharenting und erklärt, warum zum Upload von Fotos der eigenen Kinder eine Einwilligung des einwilligungsfähigen Kindes oder eines Ergänzungspflegers erforderlich ist. Außerdem zeigt er Wege auf, wie sich die Diskrepanz zwischen rechtlicher Bewertung und gelebter Praxis des Sharenting überwinden lässt.
Die öffentlich-rechtliche Namensänderung nach dem Namensänderungsgesetz erfordert einen wichtigen Grund. Die Voraussetzungen hierfür werden nach überkommenem Verständnis restriktiv ausgelegt. Namensänderungen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage sollen Ausnahmecharakter haben und nur dazu dienen, individuelle Unzuträglichkeiten in gesondert gelagerten Einzelfällen zu beseitigen. Die am 1.5.2025 in Kraft getretene Namensrechtsreform beschränkt sich im Wesentlichen auf das Namensrecht des BGB und das Internationale Privatrecht. Obwohl der Gesetzgeber das Namensänderungsgesetz unverändert gelassen hat, stellt sich die Frage, ob sich die weitgehenden Liberalisierungen der Namensrechtsreform auf die Auslegung des öffentlich-rechtlichen Namensrechts auswirken.
Over the centuries, in the European context, life-in-common has been organized in different ways although until very recently the undisputed predominance of marriage has stood out. In addition, the combination of today’s means of communication with the implementation of one of the fundamental goals of the European Union (EU) – the free movement of goods, persons, services and capital – has led to an exponential increase in the number of couples of different nationalities, with obvious consequences for the laws governing their property relations. What are the rules governing the property of married and unmarried couples? Are there any similarities or connections between these systems? Is there a tendency towards unification or harmonization? These are the three main questions that this study seeks to answer. After examining the property regimes applicable to marriage, registered partnerships – if any – and cohabitation in the twenty-seven countries that currently make up the EU, in England and Wales, and in some others that have never been part of the Union (Norway, Switzerland and Iceland), an attempt will be made to shed some light on the question of the convergence or divergence of Family law in Europe. Finally, a brief reference will also be made to the two EU Council Regulations adopted on 24 June 2016 on enhanced cooperation in the field of jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions in matrimonial property regimes and on the property consequences of registered partnerships.
This article examines how abusive fathers may exploit family court systems post-separation to maintain coercive control over former partners and children. Drawing on evidence from common law jurisdictions including the UK, Ireland, Australia and the United States it shows how repeated litigation, economic abuse and false parental alienation claims are used to continue dominance under the guise of parental involvement. Despite increased recognition of domestic abuse, family courts often prioritise shared parenting and contact, misinterpreting protective actions by mothers as ‘implacable hostility’. These assumptions can obscure patterns of post-separation abuse and place survivors and children at further risk. The article proposes the integration of the Duluth Post-Separation Power and Control Wheel as a tool to help recognise coercive legal strategies, frequently minimised as routine conflict. It argues for a shift towards contextual, pattern-based risk assessments in private family law, backed by statutory training and legal reform. By equipping practitioners to recognise how legal and institutional processes may be weaponised, family courts can better distinguish coercive control from mutual conflict and respond accordingly. This approach aligns with the principles of the Domestic Abuse Act 2021, promoting safer outcomes and ensuring that child welfare and survivor protection are prioritised in post-separation proceedings.
Should the European Union recognise ‘digital inheritance’ as a right? How should individual self-determination be reconciled with restrictions on freedom of testamentary disposition in property law? This essay aims to provide a framework for discussing these issues through a comparative analysis of the regulatory models established in the United States and a number of continental European countries. It should be noted that freedom and dignity, as the foundations of the right to privacy and inheritance law, play a central role in the design of these models.
Unter den Gesichtspunkten der Sicherstellung wirtschaftlicher Kontinuität und der Nachlassfürsorge hat der Einsatz von transund postmortalen Vollmachten im Rechtsverkehr überragende Bedeutung. Die Reichweite der Befugnisse des Bevollmächtigten und damit letztlich auch die praktische Brauchbarkeit als taugliche Übergangslösung hängt von der Beantwortung zahlreicher Rechtsfragen ab, die sich daraus ergeben, dass die Vollmacht einerseits Mittel privatautonomer Gestaltung und damit Gegenstand des 1. Buches des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist, aber andererseits auch aufgrund ihrer gleichsam erst post mortem einsetzenden Wirkung das 5. Buch tangiert.
To ensure legal certainty, predictability, comity among nations and party autonomy, judges are faced with the application of foreign law. This poses specific problems such as a (perceived) reduced quality of justice due to the judge’s unfamiliarity with the foreign law. There are, however, certain techniques that allow the judge and parties to resort to the lex fori. By comparing legal rules, court practices and scholarly opinions in Belgium, England, France and Germany, I identify ten such techniques. Some of these techniques are very reasonable (e.g., if in urgent cases there is no time to find the relevant rule of the foreign law); others are more questionable (e.g., if the judge after a brief examination concludes that the foreign law is similar to the lex fori). The existence of these techniques has considerable implications for our understanding of private international law by putting into question the separation between jurisdiction and the applied law, and for the practicing lawyer by providing opportunities to apply the lex fori regardless of the lex causae.
Recent case law from the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR) has declared practices involving the pushback of individuals, including those seeking asylum, to be illegal. This is a significant and positive development. This article examines the approaches taken in key cases before these two courts, comparing and reflecting on how they have framed pushbacks as a violation of fundamental rights and the procedural obligations that States have under international and European law. While both courts have ruled these practices to be in breach of applicable laws, their framing of the violations has differed. The ECtHR has focused on the fundamental rights that are threatened when individuals are pushed back across borders. In contrast, the CJEU has previously concentrated on the violations of procedural rules that occur during the forcible return of individuals. However, in the recent case of MA, the CJEU acknowledged that the breach of procedural rules inherent in pushbacks undermines access to effective protection, resulting in a denial of access to asylum. This situation constitutes a breach of Article 18 of the Charter of Fundamental Rights. This important development indicates a convergence in the approaches of the two courts, both condemning pushbacks as violations of individual rights and highlighting the necessity of the right to enter as an integral part of the effective right to asylum.
Since the end of the Cold War, a rejuvenated wide-ranging debate has unfolded about reforming the UN Security Council (SC) even though states have not reached any agreement. This paper considers the goals that should inspire any reform of the SC. Should it be made explicit in what capacity the Member States act: in their own interest, that of their geographical group, or to promote the purposes of the United Nations? A review of the voting patterns in the SC and the resolutions blocked by the vetoes of permanent members show the core issues blocking the institution. The voting pattern allows us to better understand the scope of the reform proposals. We distinguish between reforms advocating enlargement ‒ adding new members without altering other procedures ‒ and those involving a wider restructuring, also limiting the veto power of the permanent members. Finally, we suggest exploring legal and political mechanisms to include regional organizations, starting with the European Union.
The article aims to discuss the most recent practice of institutional sanctions in light of contested fundamentals of the law of International Organizations (ios). The analysis delves, in particular, into sanctions adopted by ios having technical mandates in situations of wider political disputes among members, concerning international peace and security issues, amidst the United Nations (UN) Security Council’s failure to take coercive measures under Chapter vii of the UN Charter. Of special interest is the suspension of membership rights and privileges which some technical ios have deliberated following the conflict in Syria and the undergoing war in Ukraine (para. 2). These instances offer a test bed to challenge the fundamental theoretical paradigm of the law of ios, that is functionalism, and to extract some ambiguities underlying the essence of ios, revealing the continuous oscillation between policy and technocracy, which is endemic to the institutional life of every io and is well reflected in the different attitudes of the members and the Secretariats. The article highlights, in particular, the tension between politics and law that emerges from the adoption of sanctions by ios endowed with highly technical tasks (para. 3), the invocation of the ‘politicisation’ mantra by the targeted member to oppose the application of the privative measures (para. 4), and the ambivalent use of functionalist ‘language’ within the reacting io (para. 5). The article concludes with some final remarks on the ‘strategic’ use of ios (para. 6).
This article examines the theoretical foundations of international security and regime theory that lay strict conditions for the creation of international regimes to explain the nature of the cyber conflict and the reasons that prevent the creation of a global regime for cybersecurity. This article analyzes the cybersecurity concerns and interests of the world’s leading powers in cyberspace ‒ China, Russia, the European Union, and the United States ‒ based on some key cybersecurity issues in dispute, inter alia, information sovereignty, militarization of cyberspace, and their politics of cyber norms. The article suggests that the absence of a dominant hegemon in the international system, and the perception of cyberspace not only as a domain that increases vulnerabilities and threats, but also as a domain for gaining a strategic advantage, does not meet the theoretical premises for the creation of an international regime.
Over the past 45 years, the number of countries and economies undertaking commitments to open their government procurement markets to foreign suppliers has expanded dramatically. They include 49 members of the World Trade Organization’s Government Procurement Agreement (GPA) and parties to more than 350 free trade agreements (FTAs). This reflects the important role that government procurement plays in international trade. Three factors behind the GPA growth to date (enlargement of the European Union, commitments to seek membership by incoming WTO members, and accessions) are not expected to propel its future growth in the same manner. While the GPA will continue to add new members—albeit slowly, FTAs will provide the principal expansion of international procurement commitments, as they encompass both GPA parties and those outside the plurilateral agreement and tailor commitments to the interests and sensitives of their parties. At the center of the FTAs are the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Agreement, the European Union’s active negotiating agenda, and the United Arab Emirates’ emergence as a major proponent of FTAs. While the GPA’s membership is outpaced by FTAs, it will continue to serve as the international gold standard for government procurement provisions and the foundation for procurement rules across the globe. The outlier to the pursuit of FTAs and a potential spoiler is the United States with President Trump’s America First trade policy undermining existing agreements and threatening withdrawal from the GPA and even the WTO.
This article analyses the practice of smartphone data extraction (SDE) employed by the German Asylum Authority (Federal Office for Migration and Refugees (BAMF)). First, the article conceptualises the SDE practice showing how, before it is carried out, the asylum seeker is asked to sign a consent form. SDE may entail risks for asylum seekers. Secondly, the article delves into the new in force, but not yet applicable, Asylum Procedure Regulation. The Regulation maintains the need to uphold the GDPR provision that consent (by the data subject) must be freely given, specific, informed and unambiguous. This Regulation establishes the asylum seeker’s enhanced obligation to collaborate with asylum authorities in relation to SDE and the detrimental procedural consequences of non-compliance with this obligation. Lastly, the article examines whether the consent given by asylum seekers to SDE, in view of the aforesaid, is meaningful enough to be considered valid by focusing the analysis on the “freely given” condition of consent under the GDPR. The article concludes that the condition “freely given” necessary for consent to be valid is not met, rendering the practice unlawful if the legal basis chosen for SDE is consent.
The International Maritime Organization’s member states are considering a range of measures to reduce greenhouse gas emissions from shipping, including a fuel oil levy to fund low and zero carbon technology research and development. This article evaluates whether the International Maritime Organization is legally bound by the United Nations Convention on the Law of the Sea ‒ in particular its Articles 203 and 278 ‒ despite the organization not being a party to the Convention and not having expressly accepted the obligations it imposes. The article critically analyses and applies the pacta tertiis principle and examines whether the relevant portions of the Convention constitute an ‘objective regime.’ It then considers what viewing the Convention as binding would mean for the imo’s implementation of the proposed levy and its other climate measures, and how doing so could help unify the climate and maritime legal regimes.
States compete in seeking to host international institutions. To this end Germany recently adopted a national host state act offering interested institutions and their organizational units an extensive catalogue of privileges and immunities. This piece presents the act and addresses the question of its applicability to organizations and any subsidiaries hosted under earlier international instruments.
The article studies how German lawyers under the swastika justified the German aggression against Poland in 1939 and questioned the support of the United States for Poland and its Allies. It distinguishes three lines of argument: First, they claimed that the Kellogg-Briand Pact was devoid of normative content and thus could not bind the German Reich. This argument was coupled with a political critique of the League of Nations Covenant and the Kellogg-Briand Pact as instruments for maintaining the territorial status quo. Second, they put forward that the German Reich was acting in self-defence and that it was Poland, France, and Great Britain who had violated the Covenant and the Pact. Third, they rejected efforts to reconceptualise the existing rules of neutrality in light of the Covenant and the Pact. Reliance on a more traditional understanding of neutrality was intended to raise legal obstacles to siding with Poland, France, and Great Britain for third states such as the United States.
From climate change to genocide, front page news is increasingly becoming the business of international courts. These cases are typically brought before the International Court of Justice on the basis of common interests in compliance with obligations owed to the international community or collective/shared responsibility associated with global challenges. Taking stock of recent developments, the present contribution considers how common-interest and common-space litigation has impacted the architecture of international justice in terms of legal interests, legal standing, third states’ interventions, and reparations, prompting the emergence of new institutional approaches to tackling these issues. In the attempt to sketch a narrative about the past and future of common-interest and common-space litigation (and the role of international judicial institutions therein), this article intends to provide a history-sensitive account of the ‘juridification’ process of common interests, and show the centrality of international courts and tribunals to the juridical life of common interests and common spaces. At the same time, it aims to illuminate how international justice has adapted to the challenges of international adjudication. Ultimately, it prompts reflections as to the evolving institutional dimensions of international justice in regard to common interests and common spaces.
This article provides a comparative analysis of the law and practice of regional international organizations (rio s). Drawing upon the International Law Association (ila) study and individual regional reports, the article offers a cross-regional account of organizations located in Europe, Eurasia, the Middle East, Africa, Latin America and the Caribbean, and the Asia-Pacific. The article focuses on the main conceptual questions that emerged during the study and reflects on some of the main insights gleaned from the cross-cutting comparisons. The article discusses the concept of ‘regional international organization’ and the debates about the appropriate definition to be used in the Study. The article discusses how international law applies to, and within, regional international organizations, examining issues such as the autonomy of the organization’s internal law. The article shows how regional international organizations have influenced the development of international law, by concluding treaties, contributing or catalysing relevant practice to the formation of customary international law, and producing authoritative ‘subsidiary means’ to identify the law. The comparative assessment allows us to offer reflections on the ‘openness’ of regional international organizations and the conditions under which they can shape, and be shaped by, international law. The article concludes with some starting points for further research on the place of regional international organizations.
The International Labour Organization’s request for an International Court of Justice (icj) advisory opinion on protection of the right to strike under the Freedom of Association and Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) entails much more than first meets the eye. At stake is the coherence of the regular and special procedures available under the ilo Constitution in case of a failure to give effect to a ratified Convention, and ultimately, also the raison d’être and functioning of the tripartite organization itself. This article traces the emergence of the practice of the various procedural bodies involved (with a focus on the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations and the Committee on Freedom of Association), the origins of the current controversy over the right to strike, and challenges arising out of recent jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECtHR) on the topic. Exploring the judicial/legislator dialectic, this article points out the contradictions and offers solutions for achieving coherence based on ilo constitutional provisions.
The Nordic Investment Bank (nib) is an international financial institution created in 1975 by the Nordic Council of Ministers to promote investment projects and exports in the Nordic region. In 1998, a new Agreement and Statutes replaced the previous ones and established the international character of the institution. Following the collapse of the Soviet Union, nib started to provide financing to the Baltic states which in 2004 became full members under a new Agreement. The three establishing treaties have marked the evolution of nib: first, a common institution of the Nordic countries; then, an international financial institution of the Nordic countries; and, finally, a Nordic-Baltic international financial institution. In this process, a key point is to appreciate whether and to what extent nib has continuously operated as a legal entity across the succession of establishing treaties.
Conventional wisdom dictates the ten elected members (E10) operate within the predominance of the five permanent members (P5) in the UN Security Council. Often also constrained by limited internal resources, many of the E10 need to ensure external support to promote their interests. In research, however, limited theoretical disaggregation exists on E10 strategies and conditions affecting their maneuvering to obtain influence. To address this gap, this article draws on existing research to form a framework and further inform this by using material from Sweden’s term (2017–2018) related to how Sweden sought to contribute to the progress of Women, Peace and Security. The article uses qualitative empirical material from thirty semistructured interviews of Swedish diplomats, other Member States of the Council, UN officials, scholars, and civil society advocates. The utility of this framework demonstrates the efficacy of E10 power, thereby opening up new avenues for future research.
In his paper on ‘The Love for International Organizations’, Jean d’Aspremont mentions a number of drivers behind the scholarly interest in the phenomenon of international organizations. Inspired by that paper, the present contribution argues that the European Union is an attractive object of study because it allows us to locate power and because the Union’s creation may have helped to build a unique cooperation among European states. Perhaps more than the drivers suggested by d’Aspremont, this contribution addresses the unclear, ever-changing and complex identity or nature of the EU as a reason for the affection both authors admittedly have for the EU. The paper revisits the classic question of whether the EU can be seen as an international organization and argues that any claims pointing to a sui generis nature of the EU do not seem to be very helpful.
Ob und welche Verbindungen zwischen Menschen und politischen Gemeinschaften notwendig sind, um rechtliche Anerkennung beanspruchen zu können, wird im Staats‑, Völker‑ und Europarecht kontrovers diskutiert. Der weltweit zu beobachtende Anstieg missbräuchlicher Verleihungs‑ und Aberkennungspraktiken der Staatsangehörigkeit hat diese Frage erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Nicht selten erfolgt die unilaterale Zuordnung und Entsagung von Personalhoheit aus strategischen Motiven, um geopolitische Ziele zu erreichen. Die seit Jahren betriebene Passverteilung Russlands in grenznahen Gebieten, für die der Begriff Passportisation bislang wissenschaftlich reserviert ist, zeigt das plastisch. Ähnliche Praktiken sind, wenn auch niedrigschwelliger, in Mittel‑ und Osteuropa bis in Mitgliedstaaten der Europäischen Union sichtbar.
This paper aims to answer whether cities are emerging as international lawmakers or shapers in human rights law, which is connected with the normative value of the results of such law-making/shaping. After a short introduction, an example of international agreement between cities, the European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City will be examined and compared to the European Convention on Human Rights and the European Social Charter (both inter-state treaties). The former is part of the emergence of cities as international lawmakers/shapers and part of the global and multi-level governance architecture. Then, the paper will present the case study of Barcelona, focused primarily on Barcelona’s implementation of the European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City. Finally, the paper will provide the answer to the above question with some concluding remarks.
The UN Development Programme introduced the human security concept in 1994 to address the diversity of challenges to people’s survival, livelihood, and dignity in seven key areas: personal, food, health, economic, political, community, and environmental security. A voluminous literature has since engaged its definitional parameters, theoretical implications, and practical applications. Yet neither dignity nor community security, defined in part to include cultural traditions and identities, have attracted much attention despite considerable human and community insecurities caused by assaults on cultural heritage which, as emblematic of distinctive cultural identities, have downward effects on dignity. This article aims to correct that gap. It identifies and examines three security markers to ascertain and redress the sufferance of indignities and insecurities pertaining to heritage, dignity, and community security: ensuring use of heritage; promoting its transmission; and protecting and advancing cultural rights.
Täisteksti saab lugeda siit.
Täisteksti saab lugeda siit.
Täisteksti saab lugeda siit.
What is the significance of the Solange I judgment for situations when national constitutional courts (NCCs) are called upon to implement or resist the implementation of an act of an international organisation (IO)? May, or even should these courts follow the German Federal Constitutional Court (FCC) and indirectly review the compatibility of the measure with the national constitution? What considerations should shape these courts’ approach? In responding to this question, this essay inquires about the positive and negative effects of such an exercise of indirect review on IOs beyond the European Union (EU): could such a review undermine the functionality of the IO or its impartiality? I will present an argument in support of the Solange I approach and explain how and why indirect review by NCCs is more likely than not to contribute to an improvement in the functionality and impartiality of IOs. My argument will be partially based on integrating into the Solange I framework the FCC’s 2021 judgment of Neubauer, in which the Court extended the Basic Law’s protection also to people living abroad. I contend that such an indirect review by an NCC that pays due regard not only to national interests, but also to the rights of foreigners that may be affected by the NCC’s decision to implement or reject the IO measure could improve the functionality of IOs and their adoption of inclusive and accountable outcomes that balance the rights and interests of all affected by the IO.
Die Überlegungen zum Umgang des Verfassungsrechts mit Fachwissen befassen sich mit dem rechtspraktisch tatsächlich gepflegten Umgang, seinen Erscheinungsformen, seiner verfassungsrechtlichen Verankerung und durchaus auch seinen Problemen, nicht mehr aber im Schwerpunkt mit der Frage, ob und wie ein solcher Umgang theoretisch begründet werden kann. Der Fokus des Beitrags liegt auf dem deutschen Verfassungsrecht, seinem Tatsachenbezug und den dazu gegebenen Wissensbeständen.
This paper focuses on the implications of Solange IV (‘Right to be Forgotten II’) and argues that this judgment is at least as bold as Solange I was at the time since it promises to overcome the classic ‘nationalisation’ of European conflicts and to make European Union (EU) constitutional law (fundamental rights) the focal point of debates about the decisions of a truly European polity. The paper argues that despite its German label, Solange IV is a truly European approach to which the German Federal Constitutional Court (GFCC) was only a latecomer. This new model bears the potential to catalyse a more genuine and meaningful engagement with the Charter by constitutional courts, thereby fostering the integrative dimension of EU constitutional law. This is potentially further strengthening the role of Art. 2 Treaty on European Union (TEU). At the same time, it risks the disintegrative effects of divergent national interpretations and still leaves room for side-lining EU standards through interpretation. Some domestic constitutional courts, however, seem to resist this new development, opting instead to rearticulate Solange II and combine it with a principle of consistent interpretation. While this is potentially an attractive avenue for constitutional orders with a strong social acquis, we argue that this strategy is neither without risks nor without alternatives.
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Klimaschutzbeschluss vom 24.3.2021 grundrechtsdogmatisches Neuland betreten, indem es die Figur der „eingriffsähnlichen Vorwirkung“ entwickelt hat. Demnach sollen staatliche Maßnahmen, die nicht ausreichen, um ein in der Zukunft liegendes Schutzziel zu erreichen, schon heute als Grundrechtseingriff zu qualifizieren sein. Der Beitrag beleuchtet diese Figur kritisch und stellt die Frage, ob nicht das hergebrachte Instrument der grundrechtlichen Schutzpflicht, die laut Bundesverfassungsgericht nicht verletzt sei, dogmatisch überzeugender gewesen wäre. Ausschlaggebend sind insbesondere die dogmatische Einordnung staatlichen Unterlassens, der Umfang staatlicher Verpflichtungen aus Art. 20a GG sowie die fragliche Gegenwartswirkung solcher „Eingriffe“.
Digitale Wahlkämpfe verändern die Spielregeln des politischen Diskurses: Durch politisches Microtargeting werden politische Botschaften an die Interessen der jeweiligen Zielgruppen maßangepasst. Dies geschieht meist intransparent und mit der Absicht gezielter Manipulation und ist daher aus demokratischer Sicht besonders problematisch. Die EU hat hierauf mit der VO (EU) 2024/900 reagiert, die erstmals einheitliche Regeln für politische Werbung schaffen soll und ab dem 10. Oktober dieses Jahres uneingeschränkt gilt. Der Beitrag analysiert die neuen Vorgaben zu politischer Werbung und hinterfragt kritisch, ob sie den Gefahren, die insbesondere von personalisierter politischer Werbung ausgehen, wirksam begegnen können.
Im Mittelpunkt des Beitrags steht die Ende des Jahres 2024 erschienene, vollständig überarbeitete Neuauflage des vom Bundesministerium der Justiz herausgegebenen Handbuchs der Rechtsförmlichkeit. Die Neufassung sieht insbesondere für die Änderungsrechtsetzung grundlegende Änderungen vor, die hier vorgestellt werden. Zugleich wird der Frage nachgegangen, ob das mit der Neuauflage verfolgte Ziel der Vereinfachung rechtsförmlicher Regeln erreicht wurde.
Die Gesetzgebung ist nach traditioneller Auffassung u.a. davon geprägt, dass sich der parlamentarische Gesetzgeber grundsätzlich nicht durch einfaches Recht selbst binden kann. Gleichwohl bestehen in der Rechtsordnung stellenweise Ausnahmen von diesem Grundsatz. Es handelt sich hierbei dann um Obergesetze, die im Rang zwischen Verfassung und einfachem Recht stehen. Die formale Etablierung von solchen Obergesetzen könnte dem Gesetzgeber insbesondere eine Möglichkeit zur wirksamen Übernahme von Langzeitverantwortung unabhängig von jeweils bevorstehenden Wahlen einräumen und dadurch eine nachhaltigere Gesetzgebung ermöglichen. Aktuelle politische – und rechtliche – Bedeutung erlangt die Frage nach Obergesetzen derzeit im Rahmen des Projekts der Sozialisierung großer Wohnungsunternehmen im Wege eines angestrebten „Vergesellschaftungsrahmengesetzes“ in Berlin. Der Beitrag untersucht die allgemeinen rechtlichen Voraussetzungen und die Natur von Obergesetzen und beleuchtet in diesem Zusammenhang rechtspolitische Erwägungen zur Einführung von Obergesetzen.
Chief justices in Central Europe ‒ defined as the presidents of the supreme court ‒ are powerful and consequential actors. Politicians in the region are well aware of this fact and have sought to undermine, bypass, or replace them. This article shows that chief justices have, in many cases, fought back. It argues that the increased supranational protection of judicial independence in Europe has changed the dynamics between chief justices and their domestic governments and, more broadly, has increased the likelihood of judicial resistance by chief justices in the face of democratic decay. Chief justices can, under such conditions, leverage supranational institutions and transnational alliances to halt or slow down backsliding. At the same time, this article cautions against uncritical supranational support for chief justices, as they may also misuse or abuse supranational protection for personal or political gain. The article concludes with suggestions for how the strategies adopted by chief justices in Central Europe can be adapted in jurisdictions outside Europe, where supranational safeguards for judicial independence are less robust.
Die wehrhafte (oder streitbare) Demokratie, als die Antwort unserer Verfassungs- und Rechtsordnung auf das Scheitern der Weimarer Republik, hat jüngst eine ungeahnte Aktualität erfahren. Damals fiel die noch junge Demokratie in die Hände der Verfassungsfeinde von rechts; die nationalsozialistische Terror- und Gewaltherrschaft war die Folge. Aktuell stellt sich die Frage, ob bzw. inwieweit unsere Demokratie ein weiteres Mal Verfassungsfeinden in die Hände fallen könnte. Anlass zu dieser Frage gibt zunächst und in besonderer Weise der Aufstieg der „Alternative für Deutschland“ (AfD). Eine Partei, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, konnte bei der Bundestagswahl 2025 mit 20,8 % die zweitmeisten Stimmanteile erringen (der Vorsprung auf die drittplatzierte SPD betrug dabei mehr als vier Prozentpunkte). In Thüringen, Sachsen-Anhalt sowie in Sachsen ist die Partei mit ihren (von den Landesverfassungsschutzbehörden) als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Landesverbänden sogar mit Abstand stärkste Kraft geworden. Ergebnisse zwischen 32,5 und 38,6 % rücken eine Regierungsübernahme auf Landesebene zumindest in den Bereich des Möglichen. Schon die Ergebnisse der jüngsten Landtagswahlen (zwischen 30,5 und 31,8 %) eröffnen hier zumindest weitgehende Blockademöglichkeiten.
In der breiten Bevölkerung erlangte der Ethikrat eine große Bekanntheit durch seine Stellungnahmen und Empfehlungen während der Pandemie. Die Stellung im politischen sowie rechtlichen Machtgefüge spielte jedoch in den vom Ethikrat angestoßenen Debatten regelmäßig keine Rolle. Das ruft Verwunderung hervor, da die Tragweite der Stellungnahmen sowie Empfehlungen vom politischen und rechtlichen Einfluss des Ethikrats abhängen. Die am 13. März 2024 vom Ethikrat veröffentliche Stellungnahme zur Klimagerechtigkeit gibt Anlass, den Ethikrat als solchen sowie seinen Einfluss zu untersuchen.
Mit dem stetigen Bedeutungszuwachs der Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes erscheint die wirtschaftspolitische Offenheit des Grundgesetzes zunehmend in Frage gestellt. Auf Grundlage einer Vergewisserung des bisherigen wirtschaftsverfassungsrechtlichen Diskurses untersucht der Beitrag, ob Art. 20a GG, intertemporale Freiheitssicherung und das Primärrecht eine Neuausrichtung des wirtschaftspolitischen Verfassungsverständnisses verlangen. Der Beitrag analysiert zudem Vorschläge zur weitergehenden Ökologisierung de constitutione ferenda auf ihre wirtschaftspolitischen Konsequenzen und blickt auf die Vorteile der (weiterhin) offenen Wirtschaftsverfassung.
In JZ 2023, 1011 (»Können extremistische Parteien in der Regierung die Nachrichtendienste für ihre Zwecke benutzen?«) erläuterte die Autorin Schneider bereits die Gefahren, die von einer extremistischen Partei in Regierungsverantwortung für die Nachrichtendienste, insbesondere den Verfassungsschutz, ausgehen. Der vorliegende Beitrag knüpft an die Diagnose an und zeigt Möglichkeiten auf, wie die Verfassungsschutzbehörden vor dem Missbrauch durch eine extremistische Regierung geschützt werden können.
This article takes the dissenting opinion of the German Constitutional Court’s 1974 Solange I-decision as a starting point to explore legal paths not taken. Based on an analysis of the majority and the minority opinions in Solange I, the article presents a reflection about what a parallel universe would look like in which the dissenting minority was not the minority and suggests some lessons that follow from this reflection. This is done against the background of the broader question of the consistency of dissenting opinions in European integration related cases before the German Constitutional Court.
Warum wird überbordende Bürokratie von der deutschen Wirtschaft mittlerweile als größter Wettbewerbsnachteil gesehen, noch vor Fachkräftemangel und Energiekosten? Warum häufen sich die Klagen der Bevölkerung über unverständliche und praxisferne Gesetze? Welche Lösungsansätze gibt es? Die Qualität der Gesetzgebung lässt sich durch mehr Faktenorientierung, ein quantifizierbares Bürokratieabbauziel, die Einrichtung eines parlamentarischen Ausschusses für Bürokratieabbau und -evaluierung und vor allem durch eine bessere Qualifizierung der Gesetzgeber verbessern. Wesentliche Merkmale sind dabei bessere Verständlichkeit, Effektivität und Praktikabilität, kostensenkende Regelungen, Digitaltauglichkeit und eine realistische Einschätzung der Gesetzeswirkungen. Eine am Unternehmensumsatz gemessene Bürokratiekostenquote könnte die tatsächliche Belastung abbilden, monitoren und als Bürokratiebremse politisch operationalisiert werden.
Aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG folgt ein Grundrecht auf finanziellen Neubeginn. Dieses Grundrecht umfasst das Recht eines jeden Menschen, nach einer Insolvenz in einem gewissen zeitlichen Rahmen vollständig entschuldet zu werden. Der Beitrag beleuchtet die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Grundrechts auf finanziellen Neubeginn und legt dar, weshalb die Ausnahme bestimmter Forderungen von der Restschuldbefreiung gemäß § 302 InsO verfassungswidrig ist.
Auslandseinsätze der Bundeswehr unterliegen den Vorgaben der Wehrverfassung. Sie sind allerdings nur dann verfassungsgemäß, wenn sie auch im Einklang mit dem Völkerrecht erfolgen. Gleichzeitig bestehen erhebliche Bedenken, ob der politische Prozess und das verfassungsgerichtliche Verfahren den Erwartungen an eine umfassende und ergebnisoffene Prüfung der Völkerrechtskonformität von Auslandseinsätzen der Bundeswehr gerecht werden können. Eine Verfassungsänderung, die klarstellt, dass nur völkerrechtskonforme Auslandseinsätze verfassungskonform sind, birgt daher erhebliche Risiken, auch und gerade für die Integrität des Völkerrechts.
Despite prominently featuring the concept of constitutional identity throughout its reasoning, the relevance of Solange I to the German Federal Constitutional Court’s doctrine of constitutional identity has been all but eclipsed by the Court’s judgment on the Lisbon Treaty 35 years later. This article makes the case for recovering Solange I’s relevance as a constitutional identity judgment. The conception of constitutional identity in Solange I is fundamentally distinguished from that in Lisbon by a near lack of references to the eternity clause of Article 79(3) Basic Law. Solange I bases itself on a notion of constitutional identity that seems explicitly susceptible to constitutional amendment. This article will use the window that Solange I offers to a conception of constitutional identity untethered from unamendability in order to challenge both the plausibility and normative desirability of linking the two. Constitutional identity, especially where it is used to set limits to the primacy of EU law, does not need to be linked to unamendability. Understanding the former as intrinsically linked to the latter gives rise to three problems: First, the problem of the hollow legitimacy of constitutional identity claims ostensibly grounded in the ‘higher legitimacy’ of acts of constituent power; second the problem of the democratic costs imposed by an increased mobilisation of amendment limits against the power of other constitutional orders, and finally, the problem of the normative mismatch between the normative considerations informing constitutional amendment limits and those informing limits to the reach of EU law. Taking Solange I seriously as a constitutional identity judgment opens a door to an understanding of constitutional identity that is freed of its problematic association with unamendability.
Der Beitrag befasst sich mit den dogmatischen Grundlagen des (partei-)politischen Neutralitätsgebots und setzt sich mit der ungeklärten Frage auseinander, ob es Regierungsmitglieder und deren Äußerungsbefugnisse auch im Deutschen Bundestag beschränkt. Dabei zeigt sich, dass wesentliche Argumente, mit denen das (partei-)politische Neutralitätsgebot begründet wird, nicht auf den Bundestag als besonderen Diskursraum übertragen werden können.
Ende 2024 wurden das Grundgesetz (GG) sowie das Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG) geändert, um das Bundesverfassungsgericht resilienter zu machen. Vor dem Hintergrund eines national wie international zu beobachtenden Wachstums an nationalistischen Parteien geht es um nicht weniger als den Schutz der deutschen Demokratie und des deutschen Rechtsstaats insgesamt. Der Beitrag skizziert und erläutert die Gesetzesänderungen, diskutiert möglichen weiteren Reformbedarf und ordnet die Reform verfassungsrechtlich ein.
Increased political polarisation has led to a proliferation of attacks against elected representatives, political candidates and party members. Verbal abuse and insults, harassment, threats and intimidation, as well as smear campaigns against politicians, occur regularly both online and offline, marking a serious degradation in the quality of political debate in the EU. During the 2024 European elections campaign, there were serious incidents in several countries. Nevertheless, acts of physical violence remain isolated and less frequent in the EU than in many other parts of the world. Violence is a risk to which politicians have always been exposed, including in democratic regimes. Organised crime and radicalised individuals or groups resort to violence to promote their political or economic agendas. EU countries have been unevenly affected; violence linked to organised crime has particularly affected certain regions, especially southern Italy, where it has proven difficult to eradicate. By contrast, violence driven by political radicalisation is a more recent phenomenon and increasingly affects all EU countries – albeit to varying degrees – and tends to flare up during periods of heightened tension, such as election campaigns and large-scale public protests. The impact on political debate, free exchange of opinions and compromise-building is profoundly negative. Violence and intimidation pressure politicians to self-censor when addressing politically sensitive issues and, in some cases, to step out of politics altogether. To counter this, several EU countries have adopted preventive and protective measures, including regular data collection. Examples include classifying offences against elected representatives as aggravated offences, simplifying reporting, and providing training, counselling and emergency assistance. Parliaments have also promoted civility and mutual respect in debates through codes of conduct and have established support services such as legal aid, psychological counselling and security assistance.
Jede offene demokratische Gemeinschaft benötigt einen Grundkonsens, der sie zusammenhält und ihr gerade in bewegten Zeiten Stabilität vermittelt. In Deutschland bestand dieser Grundkonsens lange Zeit aus dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in das Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht. Die Deutschen sind Verfassungspatrioten! Aber gilt das auch heute noch? Verfassungsjubiläen geben regelmäßig Anlass, sich der Idee des Verfassungspatriotismus gemeinsam erneut zu versichern. Beim 70. Geburtstag des Grundgesetzes 2019 konnte man das wieder sehr eindrucksvoll beobachten: Der damalige Außenminister Heiko Maas stellte fest: „Wer eine Kraft sucht, die unser Land zusammenhält, wird nicht bei denen fündig, die von Volk und Vaterland schwadronieren. Er findet sie in unserer Verfassung.“ Und Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, sekundierte: „Insofern ist es nur gut, wenn das Grundgesetz einen gewissen patriotischen Stolz weckt, den wir ruhig zulassen sollten. Denn dieses Grundgesetz ist das Fundament unserer Freiheit.“ Andere nennen das Grundgesetz das „Zentrum einer säkularen Staatsreligion“, sehen in ihm „eine Art Grundversicherung“, die „leuchtet […] wie ein behagliches Feuer in Kälte und Düsternis“. Wieder andere loben das Grundgesetz als geradezu visionär, als „die beste Verfassung aller Zeiten“. Es habe, so die damalige CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, „ein anderes Land aus Deutschland gemacht. Es ist, so unvollendet und von Rückschlägen begleitet dieser Prozess stets bleiben wird, liberaler, gerechter und viel demokratischer geworden. Das Grundgesetz erscheint, obwohl im Rentenalter, jünger denn je.“ Ja, „das Grundgesetz ist eine Erfolgsgeschichte, es gilt heute international als Musterbeispiel für eine gelungene Verfassungsordnung“.
Der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) stellte im Jahr 2021 eine völkergewohnheitsrechtliche Ausnahme von funktioneller Immunität ausländischer Staatsbediensteter bei bestimmten Kriegsverbrechen fest und weitete sie im Jahr 2024 auf alle völkerrechtlichen Verbrechen aus. Der Gesetzgeber hat diese Rechtsprechung in § 20 Abs. 2 S. 2 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) kodifiziert. Die zugrundeliegende Rechtsprechung gibt jedoch Anlass zu völkerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Bedenken. Die Anwendung einer stringenten Methodik offenbart objektiv ernstzunehmende Zweifel an den vom Senat festgestellten völkergewohnheitsrechtlichen Regeln, sodass dieser die Vorlagepflicht an das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) nach Art. 100 Abs. 2 Grundgesetz (GG) verletzte. Eine Befassung des BVerfG mit der wichtigen wie umstrittenen Frage der Immunitätsausnahmen ist weiterhin möglich und sinnvoll. Eine solche Entscheidung würde eine Heilung der defizitären völkergewohnheitsrechtlichen Begründung der BGH-Rechtsprechung und der hierauf beruhenden gesetzlichen Immunitätsausnahme ermöglichen. Die Entscheidung könnte zudem zur Legitimität der Strafverfolgung von völkerrechtlichen Verbrechen in Deutschland beitragen und deren potenziellem Beitrag zur Fortentwicklung des Völkergewohnheitsrechts ein größeres Gewicht verleihen.
This paper examines the recognition of abuse of rights in Italian and European Union (EU) law, with the aim of investigating whether general interests can be taken into account when reviewing the exercise of private law prerogatives. After providing an overview of the diverse categories of abuse of rights concepts, the paper underscores the prevailing understandings of abuse of rights and its main applications in the context of Italian and EU law. In particular, the question of whether the potential environmental implications of the exercise of a right is dealt with in the context of neighbours’ relations, general contract law and consumer law.
This paper considers the doctrine of abuse of rights in the neighbouring jurisdictions of Scotland and England, with a particular focus on property law. As shall be explained, both jurisdictions afford limited or indeed very limited space to restrict an owner from undertaking an otherwise lawful act that is done out of malice to another. For better or worse, this also curtails any considerations of wider collective interests to militate against the actions of an owner by private law means. That notwithstanding, the paper provides an analysis of wider notions of abuse of rights in Scots and English law, details when the Scots law doctrine of aemulatio vicini could still theoretically apply to forbid an abuse of rights, and highlights alternative devices that could protect a neighbour or indeed the wider public from the whims of a landowner.
Große Sprachmodelle wie ChatGPT und Gemini zeigen inzwischen ein beachtliches Leistungsniveau bei der Lösung juristischer Prüfungsfragen. Auf Grundlage von 200 Multiple-Choice-Fällen dokumentiert der Beitrag die Entwicklung der maschinellen Entscheidungssicherheit zwischen 2023 und 2025. Die Analyse zeigt eine signifikante Steigerung der Trefferquoten, offenbart aber auch strukturelle Grenzen der Modelle bei komplexen, mehrgliedrigen Fallkonstellationen. Der Beitrag bewertet die Einsatzmöglichkeiten aktueller KI-Modelle im juristischen Alltag und zeigt, wo der Mensch der Maschine überlegen bleibt.
In der Literatur sowie insbesondere in der Rechtsprechung ist die Auffassung vorherrschend, dass Geschäftsunfähigkeit i.S.d. § 104 Nr. 2 BGB absolut zu verstehen sei: Eine Person ist hiernach für alle Geschäfte entweder geschäftsfähig oder geschäftsunfähig. Die rechtsgeschäftliche Handlungsfähigkeit ist dementsprechend auch nicht anhand des konkret abgeschlossenen Rechtsgeschäfts, sondern stets abstrakt festzustellen. Der abstrakte Prüfungsmaßstab wird aber zum einen in der Praxis nicht konsequent durchgehalten. Zum anderen werden so Rechtsgeschäfte unter Umständen für nichtig erklärt, obwohl dies zum Schutz des Betroffenen gar nicht erforderlich wäre, während zugleich Schutzlücken bleiben, die auch anderweitig nicht geschlossen werden. Daher sollte die abstrakt verstandene Handlungsfähigkeit, wie schon länger gefordert, zugunsten einer relativen Betrachtungsweise aufgegeben werden.
Since the early XXth century, the abuse of rights is accepted as a general principle of law, particularly in the legal systems of the continental Europe. Its main purpose is to prevent the use of law for a dishonest purpose and preclude situations in which the defence of legality allows to escape responsibility for inflicting harm on another. The paper presents the abuse of rights principle in Polish private law, with an additional consideration of its relationship to the boundaries of ownership, which overlap with the abuse of rights criteria. A general evaluation of the utility of the abuse of rights concept in private law and its current use is made, with consideration given to how general interest was framed and distorted during the communist era. It will be shown that the complicated evolution of the doctrine in Polish law influences the extent to which the general interest may be incorporated into the assessment of exercising rights secured by private law. It is argued that the abuse of rights principle in private law must balance the interests of entities in private law relationships and not merely or predominantly secure the general interest. Protecting the latter should be achieved primarily through public law provisions. Increasingly important social values and goals, such as sustainable development, may be taken into account while exercising private rights, but should typically require targeted legislation, rather than reliance on the abuse of rights doctrine.
This text traces the German debate on abuse of rights and public interests beginning in the 19th century. In the 19th century, this issue was discussed from a liberal perspective. The decisive question was not whether the state’s interests influence private law, but how they do so. It was characterized by a strong insistence on precise ex ante legislation to protect the resulting freedom from subsequent interference by the courts. Under National Socialism, this protective function of subjective rights, granted by legislation, was destroyed and judges were permitted to determine ex post whether an exercise of rights conflicted with the interests of the community. After 1945, this doctrine of abuse of rights was formally continued, but conceptually bound to the Basic Law (Grundgesetz). Within the framework of constitutional law, civil courts could thus continue to sanction the disregard of public interests as an abuse of rights. The fact that this does not currently occur in Germany can be traced back to the development of alternative dogmatic solutions for considering public interests within private law.
Private ownership provides the legal infrastructure for unsustainable activities that cause existential threats to humanity, such as global warming. Particularly where regulations fail to reduce harmful emissions sufficiently, private-law limitations to ownership and their enforcement through the civil courts are destined to take a prominent place. Abuse of rights, as neighbour law and tort law, bars owners from inflicting disproportionate damage on other legitimate interests. However, it is disputed how sustainability as a public interest can feature in the application of abuse of rights and other private-law limitations. This contribution to normative private-law scholarship discusses a method for judges and scholars to integrate the public interest in sustainability into the doctrine of abuse of rights and indicates essential guardrails to be observed.
Die Stiftung ist zwar nicht qua Rechtsform, wohl aber in der Wirklichkeit überwiegend auf gemeinnützige Zwecke festgelegt. Gemeinnützige Stiftungen werden meist ehrenamtlich geführt. Daher darf die Haftung ihrer Organe nicht zu streng ausfallen. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr große Stiftungen mit professionellem und voll vergütetem Management. Daher sollte die weniger strenge Binnenhaftung nicht zu Leichtsinn verführen, denn ein einmal entstandener Schaden ohne Ersatz durch den Schädiger mindert meist dauerhaft das Stiftungskapital und gefährdet die weitere Zweckverfolgung. Im Folgenden wird untersucht, wie das deutsche Stiftungsrecht diese Spannungslage bewältigt, und welche Möglichkeiten bestehen, in der Satzung von der gesetzlichen Haftungsregelung abzuweichen.
Prompted by a recent ruling by the Belgian Supreme Court, this paper explores the role of collective interests in the context of abuse of rights in Spanish law. Beyond the specific ruling, the paper critically reviews Spanish legislation and case law in comparison with Portuguese law. Finally, it questions the need and appropriateness of maintaining this institution in current law.
The question of the potential role of the general interest in the doctrine of abuse of rights, has been playing a pivotal role in the debate among Belgian scholars. The specific reason for this debate is the judgment of the Supreme Court of Belgium of 21 October 2021, concerning overhanging branches of trees in a private park. (Hof van Cassatie 22 October 2021, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211022.1F). In the Netherlands, on the other hand, cases like the Belgian case are more often solved via other doctrines than abuse of rights. Comparing both systems therefore leads to the conclusion that although the developments in the doctrine of abuse of rights are quite similar, the debate on the potential role of the general interests is underdeveloped in the Netherlands.
This paper analyses a dataset of 560 applications from 350 organisations in the UK (though mostly England and Wales) for funding from the Access to Justice Foundation over a 17-month period, as a means of gaining ‘state-of-the-sector’ insights into the not-for-profit legal advice sector in the UK. We begin by discussing this method and argue that this is a valid, reliable, ethical and effective method for understanding the not-for-profit legal advice sector. We then explore the types of organisations applying, the ways in which they combine income streams, how they understand legal need and its drivers, and how they attempt both to meet that need and to address clustered barriers to legal advice for their client groups. The article thus offers a useful set of insights into the sector and the dilemmas facing advice organisations after ten years of legal aid cuts and local government austerity, as well as demonstrating the effectiveness of ‘mining’ data from funding applications as a source of research evidence.
Amid global climate change concerns, policymakers worldwide are increasingly scrutinizing environmentally harmful regulations. This study examines the tax deductibility of job-related commuting costs, which has faced criticism for promoting longer commutes and greater congestion. Through a controlled, randomized survey experiment, we confirm that the tax deductibility of commuting costs increases subjects’ stated willingness to accept longer commutes, albeit with minimal economic impact. Increasing the deduction rate by €0.10 per km leads to an average acceptance of 327-meter-longer (0.2 mile) commutes. In contrast, we do not find subjects to be attentive to changes in the size of the tax deduction when such changes are presented as tax-deductible expenses rather than as direct cash effects. However, abolishing tax deductibility significantly reduces stated commuting distances by approximately 1.82 km (1.13 miles). These findings highlight people’s responsiveness to the mere presence of the commuter tax break, while being less sensitive to its specific size. Policymakers should consider these findings when evaluating the effectiveness of such tax deductions in mitigating climate change or their economic efficiency effects.
Das KSchG bietet die Möglichkeit, am Bestand des Arbeitsverhältnisses bei sozial ungerechtfertigter Kündigung festzuhalten. Die Forderung nach einem Systemwechsel hin zu einer Abfindungslösung würde einen weiteren Einschnitt im Kündigungsrecht bedeuten, weil ein effektiver Schutz des gewählten Arbeitsplatzes unmöglich gemacht würde, obwohl interessengerechte Abfindungslösungen bereits nach geltendem Recht möglich sind. Zwar gibt es Verbesserungsbedarf, aber nicht mit Blick auf diese Fragestellung. Mit Recht ist die geforderte Reform daher ein rechtspolitischer Ladenhüter.
Das Mutterschutzrecht unterliegt in Deutschland ständigen Anpassungen und Weiterentwicklungen sowohl durch den Gesetzgeber als auch in der Rechtsprechung. Durch diese soll einerseits der Schutz von schwangeren Frauen und Müttern während ihrer arbeitsvertraglichen Tätigkeit sichergestellt und andererseits ihre Integration in die Arbeitswelt gewährleistet werden. Welchen Herausforderungen ein effektiver Schutz auch angesichts gesellschaftlicher Entwicklungen gegenübersteht, reflektieren die Mitte des Jahres eingeführten Neuerungen im Mutterschutzgesetz.
Vor dem Hintergrund der Relevanz der Anwendung ausländischen Rechts in der Praxis untersucht der Beitrag das Institut der Verjährung nach spanischem materiellem Recht und geht dabei auch auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum deutschen Recht sowie punktuell auf kollisionsrechtliche Bezüge und Besonderheiten ein. Der Schwerpunkt liegt wegen der praktischen Relevanz auf der Behandlung der Verjährung von deliktischen Schadensersatzansprüchen, vor allem infolge von Straßenverkehrsunfällen.
Mit den §§ 327 ff. BGB hat der Gesetzgeber Vorschriften für Verträge über digitale Produkte geschaffen. Der Beitrag analysiert das Recht auf Vertragsbeendigung bei Verträgen über smarte Sachen nach § 327a II BGB unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Rechtsregimetrennung. Im Fokus steht dabei die Auslegung des Begriffs der „Eignung zur gewöhnlichen Verwendung“ einer smarten Sache in den §§ 327c VII, 327m V BGB. Zudem wird untersucht, inwieweit die hierbei gewonnenen Erkenntnisse auf den Anspruch des Verbrauchers auf Schadensersatz statt der Leistung zu übertragen sind.
Waren mit digitalen Elementen stehen einer Chimäre gleich für die Verknüpfung der analogen körperlichen Sache mit ausgelagerten digitalen Inhalten und digitalen Dienstleistungen. Im geltenden Recht sind sie als Teil des Verbrauchsgüterkaufrechts in den §§ 475a bis 475c BGB geregelt. Danach bestehen insbesondere Ansprüche auf Aktualisierungen sowie Zugang zu Serverleistungen. Wie aber ist die Rechtslage, wenn ein Unternehmer entsprechende Waren kauft? Bestehen dann keinerlei Aktualisierungs- und Zugangsansprüche? Der Beitrag sucht diese und weitere Fragen zu klären.
Emojis sind digitale Piktogramme, die zunehmend auch in geschäftlicher Kommunikation verwendet werden. Sie werfen Fragen der allgemeinen Vertragslehre auf. Der Beitrag untersucht, unter welchen Voraussetzungen Emojis als Willenserklärungen angesehen werden können, welche Formvorschriften für sie gelten und welche Umstände bei ihrer Auslegung zu beachten sind.
Österreich hat mit der Flexiblen Kapitalgesellschaft (FlexKapG) eine neue Gesellschaftsform geschaffen. Eines ihrer Kernelemente ist die sog. Unternehmenswert-Beteiligung, mit der eine Zwei-Klassen-Struktur von stimmberechtigten und nicht stimmberechtigten Gesellschaftern typisiert geregelt wird. Damit soll insbesondere für Startups eine attraktive Rechtsform zur Verfügung stehen. Diese Reform gibt gerade vor dem Hintergrund der in Deutschland geltenden Rechtslage Anlass, eine Reihe von regulatorischen Grundsatzfragen aus neoklassischer und verhaltensökonomischer Sicht zu erörtern. Die Gegensatzpaare von Zwei-Klassen- und Ein-Klassen-Struktur, Typisierung und Privatautonomie, Schuldrecht und Gesellschaftsrecht sowie Formfreiheit und Formzwang fassen die maßgeblichen Parameter der Untersuchung zusammen.
Bei der Bestimmung des äußerungsrechtlichen Sorgfaltsmaßstabs wird bislang zwischen Privatpersonen, Medien und Hoheitsträgern unterschieden. Verbraucherorganisationen haben trotz ihres enormen Einflusses noch keine gesonderte Beachtung gefunden. Der Beitrag soll zeigen, dass Verbraucherorganisationen – wie die Medien – zur Wahrung besonderer Sorgfalt im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit verpflichtet sind. Sofern Verbraucherorganisationen dem Grunde nach dem Staat obliegende Aufgaben wahrnehmen und dafür staatliche Fördermittel erhalten, sind sie darüber hinaus zur Sachlichkeit und Mäßigung verpflichtet.
„Smart sanctions“, also Wirtschaftssanktionen gegen gezielt ausgewählte Personen, haben sich zu einem wichtigen Instrument der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union entwickelt. Der Beitrag untersucht die gesellschaftsrechtlichen Folgen von Sanktionsverordnungen, die der Rat der Europäischen Union gegen die Taliban, al-Qaida, die Islamische Republik Iran und gegen die Russische Föderation gerichtet hat, und arbeitet heraus, welche Konsequenzen das Einfrieren des Vermögens sanktionierter Personen allgemein für deren mitgliedschaftliche Rechtsposition hat.
Die deutsche Prospekthaftung ruhte lange Zeit stabil auf einer allgemeinen, von der Rechtsprechung entwickelten bürgerlich-rechtlichen und einer spezialgesetzlichen Grundlage. Allerdings baute der Gesetzgeber die spezialgesetzliche Grundlage in der Vergangenheit immer weiter aus. Diese Verschiebung in der Tektonik wurde nun jüngst zum Ausgangspukt eines offen ausgetragenen höchstrichterlichen Kräftemessens, das die gesamte Architektur der Prospekthaftung ins Wanken gebracht hat. Konkret geht es um die Frage, ob neben den ausgebauten Spezialgesetzen noch Platz für eine allgemeine bürgerlich-rechtliche Haftung bleibt. Nunmehr versuchen sich die streitenden Senate daran, die Architektur gemeinsam und ohne Einschaltung des Großen Senats wieder zu stabilisieren. Der nachfolgende Beitrag unterzieht dieses Unterfangen einer kritischen Würdigung und zeigt auf, dass es die gewachsenen Spannungen nicht umfänglich beseitigt.
Der Aufsichtsrat ist heute mehr denn je gefordert. Das Recht des Aufsichtsrats ist jedoch in die Jahre gekommen und wird dem nicht mehr gerecht. Darüber besteht weithin Einigkeit. Eine ganze Reihe teilweise sehr unterschiedlicher Reformvorschläge liegen vor. Diese sind im Hinblick auf ihre dogmatische Stimmigkeit und im Lichte der heutigen Aufsichtsratspraxis und internationalen Erfahrungen zu vermessen. Ausgangspunkt ist, dass die Aufgabe des Aufsichtsrats nicht nur eine nachträgliche Kontrolle, sondern eine vorausschauende Überwachung und Beratung ist. Das ist zwar vom Bundesgerichtshof anerkannt, sollte aber im Aktiengesetz selbst transparent klargestellt werden. Daraus folgen viele weitere, strittige Fragen, etwa Größe des Aufsichtsrats, Zusammensetzung, Annexkompetenzen und Hilfsgeschäfte, Ausstattung und Aufsichtsratsbüro, Stellung des Aufsichtsratsvorsitzenden, Information des Aufsichtsrats in der Gesellschaft und nach außen (Investorendialog), Anforderungen an den Aufsichtsrat und seine Mitglieder, vor allem was Sachkunde und Unabhängigkeit angeht, Finanzexperten, Prüfungs- und andere Ausschüsse, Pflichten und Haftung der Aufsichtsratsmitglieder, auch im Hinblick auf Interessenkonflikte, und Aufsichtsrat und Hauptversammlung. Bei alledem fragt sich, wo Reformen ansetzen sollten, nur im Aktiengesetz oder auch im DCGK. Dabei kommt es auf Transparenz und Flexibilität an, Überregulierung ist zu vermeiden.
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa (EU) 596/20141 (MAR) säädetään sisäpiiritiedon julkistamisesta ja väärinkäyttöä koskevista kielloista. Tämän artikkelin tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat MAR 14 artiklassa säädetyistä kielloista sisäpiiritiedon ilmaisukiellon ja sitä koskevan poikkeuksen suojatarkoitukset ja systematiikka MAR:n sääntelyjärjestelmässä. MAR 14(c) artiklan mukaan henkilö ei saa ilmaista sisäpiiritietoa laittomasti. Artikkelissa ilmaisukieltoa ja sitä koskevaa poikkeusta tarkastellaan lähtökohtaisesti liikkeeseenlaskijaa suoraan koskevan tiedon eli niin sanotun liikkeeseenlaskijatiedon osalta ja erityisesti arvopaperin liikkeeseenlaskijayhtiön johdon näkökulmasta. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna artikkelissa esitetään, että suoraan sovellettavasta EU-asetuksesta huolimatta MAR:ssä säädetyn sisäpiiritiedon ilmaisukiellon ja sitä koskevan poikkeuksen sisältö määräytyy edelleen keskeisesti kansallisen yhtiöoikeuden perusteella.
Seit einiger Zeit nehmen Vorstandsvorsitzende deutscher Aktiengesellschaften verstärkt zu allgemeinpolitischen Themen Stellung. Dieser Beitrag kritisiert den neuen Trend: Aus Sicht der Aktiengesellschaft und gemessen an den geltenden rechtlichen Beurteilungsmaßstäben vernachlässigen die allgemeinpolitischen Stellungnahmen häufig die Aktionärsinteressen. Den sich äußernden Vorstandsvorsitzenden kann sogar ein pflichtwidriges Verhalten vorzuwerfen sein. Zugleich kann der Vorstand zu politischen Themen angesichts eines stärker werdenden Äußerungsdrucks heute kaum schweigen. Daher müssen Wege gefunden werden – so wird hier argumentiert – das politische Handeln des Vorstands stärker auf die Interessen der AG und ihrer Aktionäre hin auszurichten. Dazu sollten die Aktionäre de lege ferenda mehr Mitspracherechte erhalten, wenn es um politische Betätigungen der AG geht.
Das „Say on Climate“ der Gesellschafter wird im GmbH-Recht bislang praktisch nicht diskutiert; auch hier ist das „Klimamitspracherecht“ jedoch von Relevanz, jedenfalls insoweit es eine materielle Entscheidungskompetenz beschreibt. Der Beitrag geht der Frage nach, inwiefern die Gesellschafter zu beteiligen sind, wenn die Geschäftsleitung – etwa auch auf Kosten des Profits – Klimaschutzmaßnahmen ergreifen will. Droht die Umsetzung einer solchen Maßnahme, ohne dass die (Minderheits-)Gesellschafter im notwendigen Maße beteiligt wurden, können diese ihr „Say on Climate“ klageweise verteidigen, wobei eine Unterlassungsklage in drei Varianten denkbar ist: als Geltendmachung des verbandsrechtlichen Unterlassungsanspruchs, als actio negatoria pro socio und als negatorische Klage analog § 1004 Abs. 1 BGB.
Der Beitrag untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen für politische Positionierungen gesellschaftsrechtlicher Organe. Im Fokus steht die Frage, inwieweit insbesondere Vorstände von Aktiengesellschaften öffentlich zu politisch umstrittenen Themen Stellung beziehen dürfen. Ausgehend von der Debatte um Corporate Social Responsibility wird analysiert, ob solche Positionierungen auch dann zulässig sein können, wenn sie nicht in einem instrumentellen Zusammenhang mit wirtschaftlichen Interessen der Gesellschaft stehen. Dabei wird auch die verfassungsrechtliche Dimension der Meinungsfreiheit juristischer Personen beleuchtet sowie deren Implikationen für die aktienrechtliche Kompetenzordnung.
Der Beitrag identifiziert Corporate Political Engagement als eine nächste Entwicklungsphase der Materialisierung des Gesellschaftsrechts — nach der Etablierung effizienter Corporate-Governance-Strukturen (2000er Jahre), der Ausdifferenzierung einer Corporate Social Responsibility (CSR) (2010er Jahre) sowie der Durchsetzung von Environment–Social–Governance (ESG)-Standards (2020er Jahre). Ausdruck dieser Entwicklung ist zum einen die politische Betätigung von Vorstandsmitgliedern (CEO Activism), deren Vereinbarkeit mit den organschaftlichen Pflichten zur Fremdinteressenwahrung in diesem Beitrag untersucht wird. Diese Pflicht zur Wahrung der Interessen der Gesellschaft führt in der Regel zu einem Sachlichkeits- und Mäßigungsgebot bei öffentlichen Äußerungen, selbst wenn diese als „Privatperson“ getätigt werden. Ferner wird aufgezeigt, dass politischen Äußerungen, die der Vorstand im Namen der Gesellschaft tätigt, als unternehmerische Entscheidungen dem Anwendungsbereich der Business Judgement Rule unterfallen können. Schließlich wird untersucht, unter welchen Voraussetzungen Verbände ihre Gesellschafter/Mitglieder oder Organe im Falle extremistischen Verhaltens ausschließen oder abberufen können; hierfür wird ein rechtsformübergreifender Ansatz entwickelt. Vonnöten ist ein wichtiger Grund, für den allein ein extremistisches Verhalten nicht ausreicht; dieses muss vielmehr einen spezifischen Bezug zum Unternehmen aufweisen.
Man kennt Philipp Jakob Siebenpfeiffer als einen der Helden des Vormärz. Seine rechtspolitischen Schriften sind weniger bekannt. 200 Jahre nach dem Erscheinen von Siebenpfeiffers »Ueber die Frage unsrer Zeit in Beziehung auf Gerechtigkeitspflege« braucht man dieses Werk zwar nicht mehr vorzustellen. Eine gründlichere Analyse lohnt aber allemal, um dem Bild Siebenpfeiffers in der Rechtsgeschichte klarere Konturen zu verleihen. Das Werk zählt nämlich zu den »Gründungsdokumenten« des reformierten Strafprozesses.
Vier Jahre nach der Reichsgründung 1871 errichtet Preußen ein Oberverwaltungsgericht als höchste Instanz für Verwaltungsstreitigkeiten. Es ist mit unabhängigen, lebenszeitigen Richtern besetzt und unterscheidet sich so von der Verwaltungsrechtspflege. Seine Rechtsprechung gilt als liberal und eigenständig, wofür neben anderen die „Weber“-Urteile stehen, die eine Premiere des Werks ermöglichten. Das „Kreuzberg“-Urteil beschränkt die vage polizeiliche Generalklausel, die unter dem hochqualifizierten Präsidenten Bill Drews schärfere Konturen erhält. Sein Senat entscheidet den Fall des „Borkum-Lieds“ zutreffend, weil er die antijüdischen Vers-Sänger als Störer ausmacht. Drews ’ 1927 publiziertes Polizeirechts-Lehrbuch gerät zum Klassiker, und er prägt auch das Polizeiverwaltungsgesetz von 1931, dessen § 14 Vorbild wird. Bis 1937 kann das Gericht rechtsstaatliche Standhaftigkeit mitunter durch listige Argumentation beweisen. Sein Niedergang endet im Jahre 1941 mit der Eingliederung in ein Reichsverwaltungsgericht.
Much of the nineteenth century is well-known to have been a period in which fundamental principles of English private law first came to be subjected to scientific treatment. Such was the significance of this period that it was assigned the epithet ‘classical’. Among the principles to have first been subjected to such treatment were those specifically concerned with the recovery of civil damages in actions at common law. This article systematically traces the process by which modern private law’s most controversial civil recovery principle – that of punishment in tort – came to be treated scientifically during this classical period. In doing so, it sheds new light on how a substantive common ‘law’ of punitive damages first actually arose.
In den wenigen Fällen, in denen die Auslegung gerichtlicher Entscheidungen in der Literatur bereits behandelt wird, erschöpft sich diese Behandlung meist in dem Hinweis, dass die »klassischen Auslegungselemente« von der Gesetzesauslegung auf die Auslegung gerichtlicher Entscheidungen zu übertragen seien, also gerichtliche Entscheidungen nach ihrem Wortlaut, ihrer Systematik, ihrer Genese und ihres Telos zu verstehen seien. Soweit ersichtlich, wird die eigentlich vorgelagerte Frage – das Ziel der Auslegung – an keiner Stelle näher erörtert.
Ausgehend von den Vereinigten Staaten hat sich in den letzten Jahren eine neue Fragestellung etabliert, die sich selbst als Politische Ökonomie des Rechts (Law & Political Economy) bezeichnet und sich als Fortsetzung der Critical Legal Studies begreift. Ihre ambitionierte Programmatik unterscheidet die LPE-Bewegung von anderen Forschungsrichtungen gleichen Namens im Grenzbereich von Recht und Ökonomie. Die Selbstbeschreibung als politisch kennzeichnet den theoretischen Anspruch durch einen doppelten Gegensatz: zu einer rein ökonomischen Ökonomie und einer rein juristischen Rechtswissenschaft. In der Sache formuliert das Manifest der LPE-Bewegung das Ziel, eine ökonomisch-juristische „Synthese des 20. Jahrhunderts“ im amerikanischen Recht zu dekonstruieren. Gemeint ist damit ein stilles ideologisches Arrangement des Neoliberalismus, das Verfassungs- und Privatrecht der Vereinigten Staaten in den 35 Jahren zwischen dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems und der Finanzkrise auf letztlich nur noch ökonomische Ziele verpflichtet habe: Im Privatrecht habe sich ein interpretatives Paradigma durchgesetzt, das die Freisetzung von Märkten unter der Maxime der Effizienzmaximierung betrieb. Normative Fragen von Gleichheit, Macht und Umverteilung seien unterdessen nur scheinbar ins Verfassungsrecht verwiesen worden, das in Wahrheit diese Fragen gar nicht mehr thematisieren konnte. Gerade in dieser Zeit habe sich nämlich das Verfassungsrecht von progressiven Paradigmen der civil rights era und einer egalitären Grundrechtsinterpretation verabschiedet und demokratische Entscheidungsprozessezunehmend nur noch mit Blick auf die Gefahr der einseitigen Durchsetzung von Partikularinteressen analysiert. Law and Economics in Gestalt von Transaktionskostentheorie und Kaldor-Hicks-Effizienz gingen so eine stille, aber wirkungsvolle Allianz mit der Rational Choice-Analyse des Verfassungsrechts ein. Im Ergebnis traf der Siegeszug der nur noch ökonomischen Interpretation des Privatrechts auf ein methodisch entpolitisiertes Verfassungsrecht. Die „20th century synthesis“ besteht nach dieser Lesart in einer dialektischen Trennung, d. h. in der funktionalen Einheit von effizienten Märkten und marktneutraler Politik.
Artikkelin aiheena on lainopillisen ja empiirisen metodin yhdistäminen tutkimuksessa. Artikkelissa käsitellään näiden metodisten lähestymistapojen yhdistämiseen liittyviä keskeisimpiä haasteita. Tutkimusotetta voi luonnehtia autoetnografiseksi. Autoetnografia tarkoittaa tutkimustapaa, jossa tutkija hyödyntää oman elämänsä havaintoja, reflektioita tai muistoja. Artikkelin analyysi pohjautuu kirjoittajan omien opetus- ja ohjauskokemusten ohella aihepiiristä tehtyyn metodikirjallisuuteen. Käytännön esimerkit liittyvät usein opinnäytetyötasoisiin töihin, mutta analyysi laajenee tästä kontekstista yleisemmälle tasolle metodikirjallisuuden tukemana.